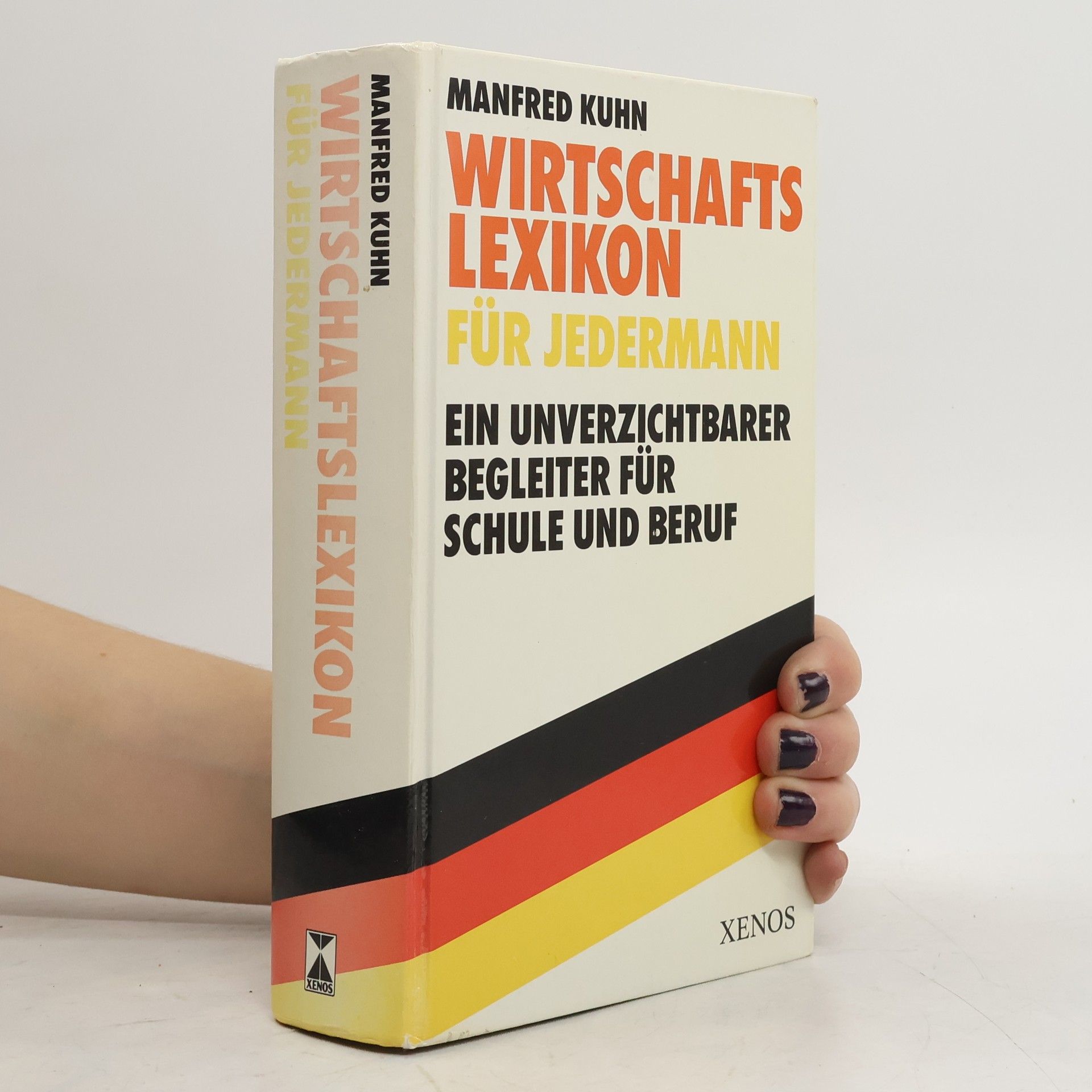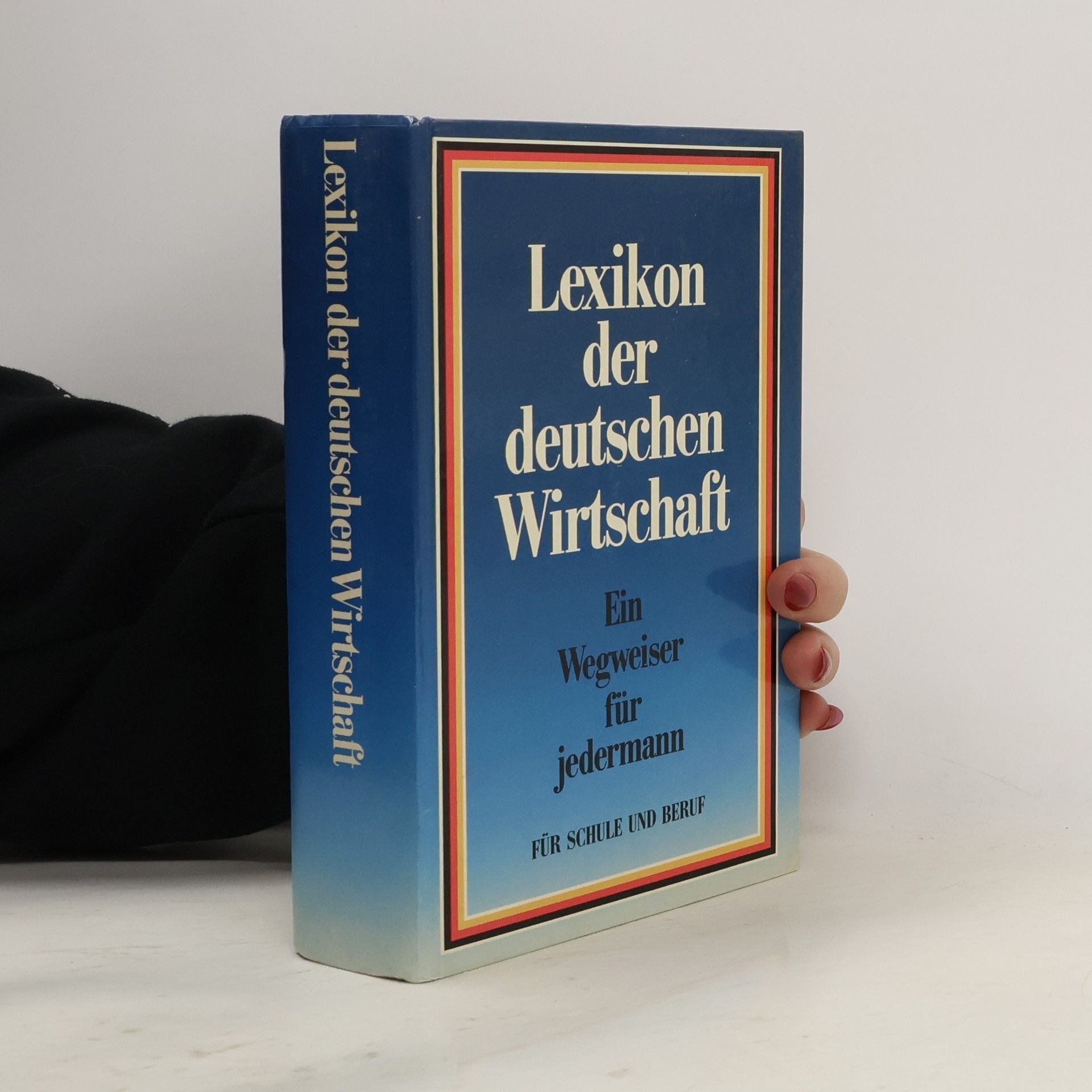»Die beste Kant-Biographie.« Frankfurter Allgemeine Zeitung Heinrich Heine hat gespottet, von Immanuel Kant könne niemand eine Lebensgeschichte schreiben, denn Kant habe weder ein Leben noch eine Geschichte gehabt. Manfred Kühn widerlegt die Legende von Kants ereignislosem Professorenleben gründlich und zeichnet das Bild eines eleganten und geistreichen Gentlemans, der eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben seiner Heimatstadt Königsberg spielte. Man nannte Kant den »eleganten Magister«. Er war ein ungemein beliebter Universitätslehrer, charmant und kontaktfreudig, von Freunden umgeben, gern auf Gesellschaften. Die bis zur Karikatur verzerrten Klischees vom pedantischen Leben Kants treffen allenfalls seine späten Jahre. Neben dem Portrait von Kants Leben und der Einführung in seine Schriften macht Manfred Kühns Biographie deutlich, wie sehr das Denken des großen Philosophen von den wichtigen politischen, kulturellen und intellektuellen Ereignissen seiner Zeit inspiriert wurde.
Manfred Kühn Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
1. Januar 1947