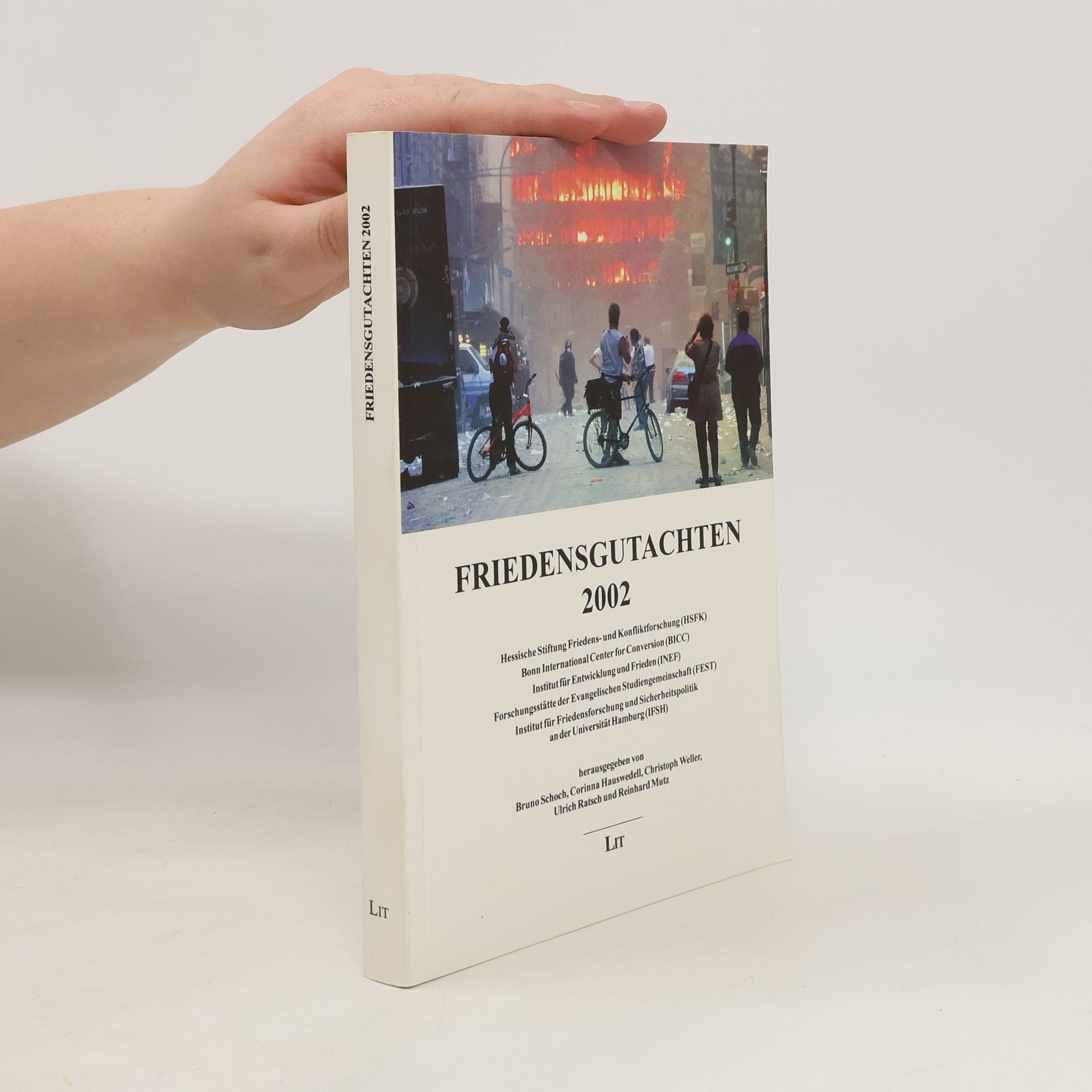Friedensgutachten 2002
- 320 Seiten
- 12 Lesestunden
Das Friedensgutachten 2002 thematisiert den 11. September und beleuchtet die weitreichenden Ursachen und Folgen, die über den Krieg in Afghanistan hinausgehen. Es wird untersucht, was den internationalen Terrorismus neu macht, aus welchen Quellen er sich speist und wie man ihm begegnen kann. Zudem wird die veränderte Weltpolitik der USA sowie die Rolle Russlands und die Reaktionen der deutschen Politik analysiert. Die Anschläge in den USA haben die Dringlichkeit der Kontrolle und Abrüstung von Massenvernichtungswaffen verstärkt. Neue Sicherheitsgesetze beeinflussen die fragile Balance zwischen Sicherheit und Freiheit in Demokratien. Während wir uns davor hüten, das neue Jahrhundert zu definieren, versuchen wir, Tendenzen zu einer neuen Weltordnung oder -unordnung zu erkennen. Fragen zur Belastbarkeit völkerrechtlicher Regeln und zur Notwendigkeit neuer Aufrüstung werden aufgeworfen. Auch die regionalen Konflikte in Mazedonien, Serbien und Montenegro, Nordirland sowie der israelisch-palästinensische Konflikt werden exemplarisch behandelt. Frieden wird als weit mehr als Terrorismusbekämpfung betrachtet; es werden zivile Konfliktbearbeitung und nachhaltige Entwicklung thematisiert, und es wird für eine neue globale Kooperationskultur plädiert. Der Internationale Strafgerichtshof wird trotz Mängeln als Fortschritt gewertet.