Musikpädagogik studieren – und was dann? Mit dieser und ähnlichen Fragen müssen sich Studierende (nicht nur) der Musikpädagogik auseinandersetzen, je näher das Magisterexamen rückt. Der Problemkomplex sollte aber auch die Hochschullehrer beschäftigen, wenn sie eine soziale Verantwortung für die berufliche Zukunft ihrer Studenten nicht ganz zurückweisen wollen. Das vorliegende berufskundliche Handbuch versucht, auf diese Fragen angesichts eines überfluteten Arbeitsmarktes vielfältige Antworten zu geben. Erfahrene Profis geben hier Auskunft über ihre Studien, ihre ersten Berufskontakte und Berufserfahrungen. Nahezu alle Werdegänge erweisen sich dabei als „Crossover-Biographien“, denn Berufswege sind oftmals Umwege, in manchen Fällen verlaufen sie geradezu mäandrisch. Die Vorstellung von dem Studium für den Beruf ist angesichts der rasanten Veränderungen in der heutigen Arbeitswelt längst überholt. Das Buch will allen Magister-Studierenden der Musikpädagogik (nebenbei auch der Musikwissenschaft) berufliche Perspektiven aufzeigen. Es will Mut machen, aber auch verdeutlichen, wie wichtig ein rechtzeitig polyvalent angelegtes Studium und ein früher Kontakt in die Berufswelt schon während des Studiums sind.
Hans Günther Bastian Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

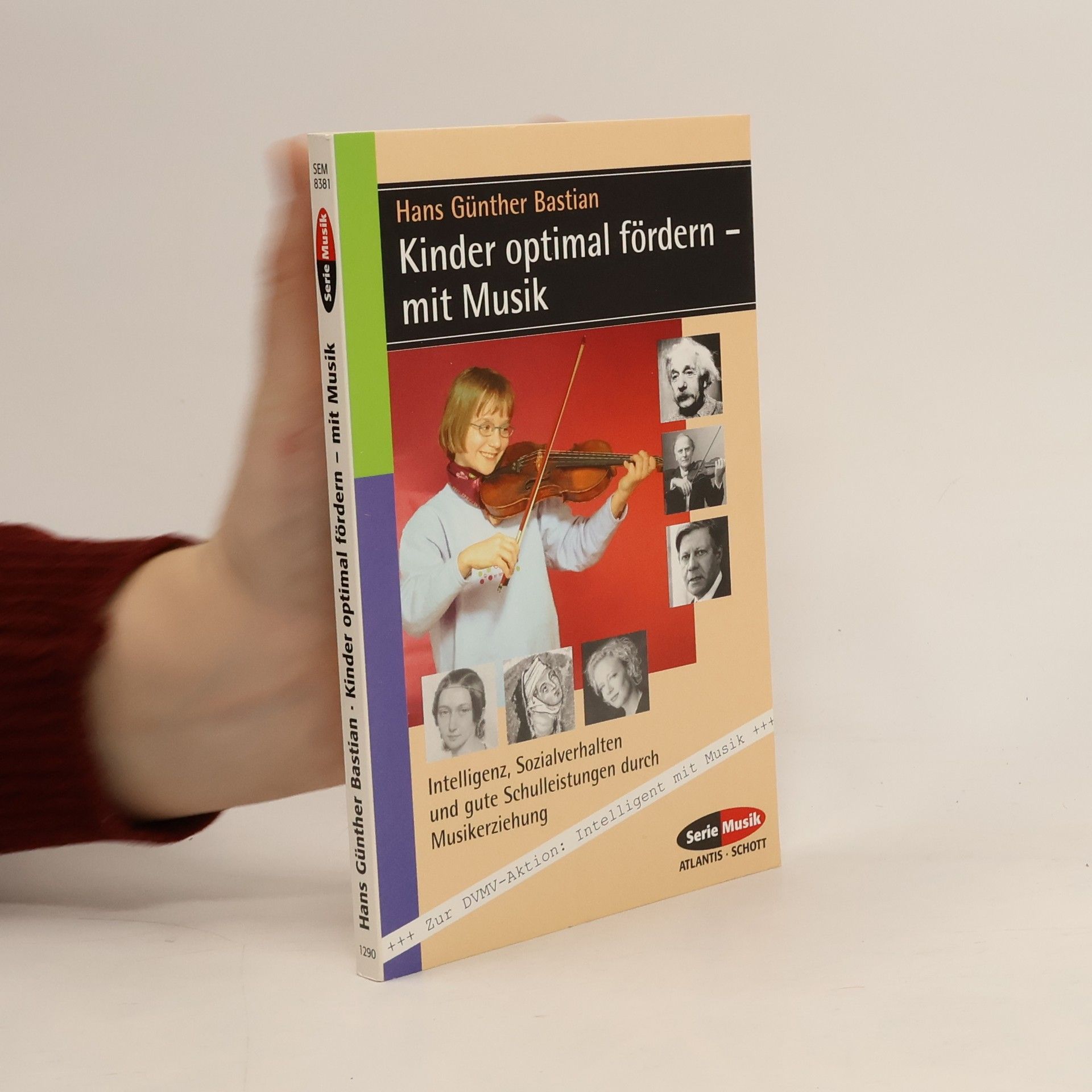

Kinder optimal fördern - mit Musik
- 100 Seiten
- 4 Lesestunden
Was haben sie gemeinsam - die Universalgelehrte Hildegard von Bingen, die Pianistin Clara Schumann, der Nobelpreisträger Albert Einstein, der Jahrhundertgeiger Yehudi Menuhin, Altbundeskanzler Helmut Schmidt und die Schauspielerin Katja Riemann? Sie haben allesamt erfahren, dass aktives Musizieren die Lebensqualität steigert - Einzelbeispiele? Nein! Eine sechsjährige Langzeitstudie mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren hat wissenschaftlich eindeutig belegt: Musizierende Kinder und Jugendliche - verbessern ihr Sozialverhalten, - erhöhen ihren IQ-Wert, - erbringen gute schulische Leistungen, - kompensieren Konzentrationsschwächen u. a. m. Professor Hans Günther Bastian, Leiter des Forschungsprojektes, fasst im vorliegenden Taschenbuch wichtige Ergebnisse der 700 seiten starken wissenschaftlichen Studie Musik(erziehung) und ihre Wirkung zusammen und bietet überzeugende Argumente für die Forderung nach einem zentralen Platz von Musikerziehung in der allgemein-bildenden Schule. Das Buch hilft Eltern, Erziehern, Musiklehrern, den Jugendlichen selbst und Politikern auf Landes- und Bundesebene zu erkennen, welches Potential in Musik und Musikerziehung steckt. Lasst uns dafür sorgen, dass in unseren Wohnungen und in unseren Schulen gesungen und Musik gemacht wird, auf dass die Nachwachsenden lernen, daran Freude zu haben. Es wird Zeit für jene Sprache, die unsere Seele ohne Umwege erreicht... (Altbundeskanzler Helmut Schmidt)
Musik(erziehung) und ihre Wirkung
- 686 Seiten
- 25 Lesestunden
Unter der Leitung des Frankfurter Musikpädagogen Prof. Dr. Hans Günther Bastian wurde zwischen 1992 und 1998 an Berliner Grundschulen eine Langzeitstudie zum Einfluss erweiterter Musikerziehung auf die Entwicklung von Kindern durchgeführt. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt umfasste über 100 Testeinsätze und die Auswertung von mehr als einer Million Daten. Die Ergebnisse zeigen, dass erweiterte Musikerziehung die Persönlichkeitsentwicklung von Grundschulkindern äußerst positiv beeinflusst. Dazu gehören signifikante Verbesserungen in der sozialen Kompetenz, eine gesteigerte Lern- und Leistungsmotivation, ein bedeutsamer IQ-Zugewinn, die Kompensation von Konzentrationsschwächen, sowie eine Förderung musikalischer Leistung und Kreativität. Zudem wird eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit und eine Reduzierung von Angsterleben festgestellt, während die schulischen Leistungen trotz zusätzlicher Belastungen überdurchschnittlich gut bleiben. Diese Studie liefert wichtige Argumente für die bildungspolitische Forderung nach einem festen Platz von Musikerziehung im Lehrplan allgemein bildender Schulen. Alle Grundschüler sollten die Möglichkeit erhalten, ein Instrument zu erlernen und in einem Ensemble zu musizieren.