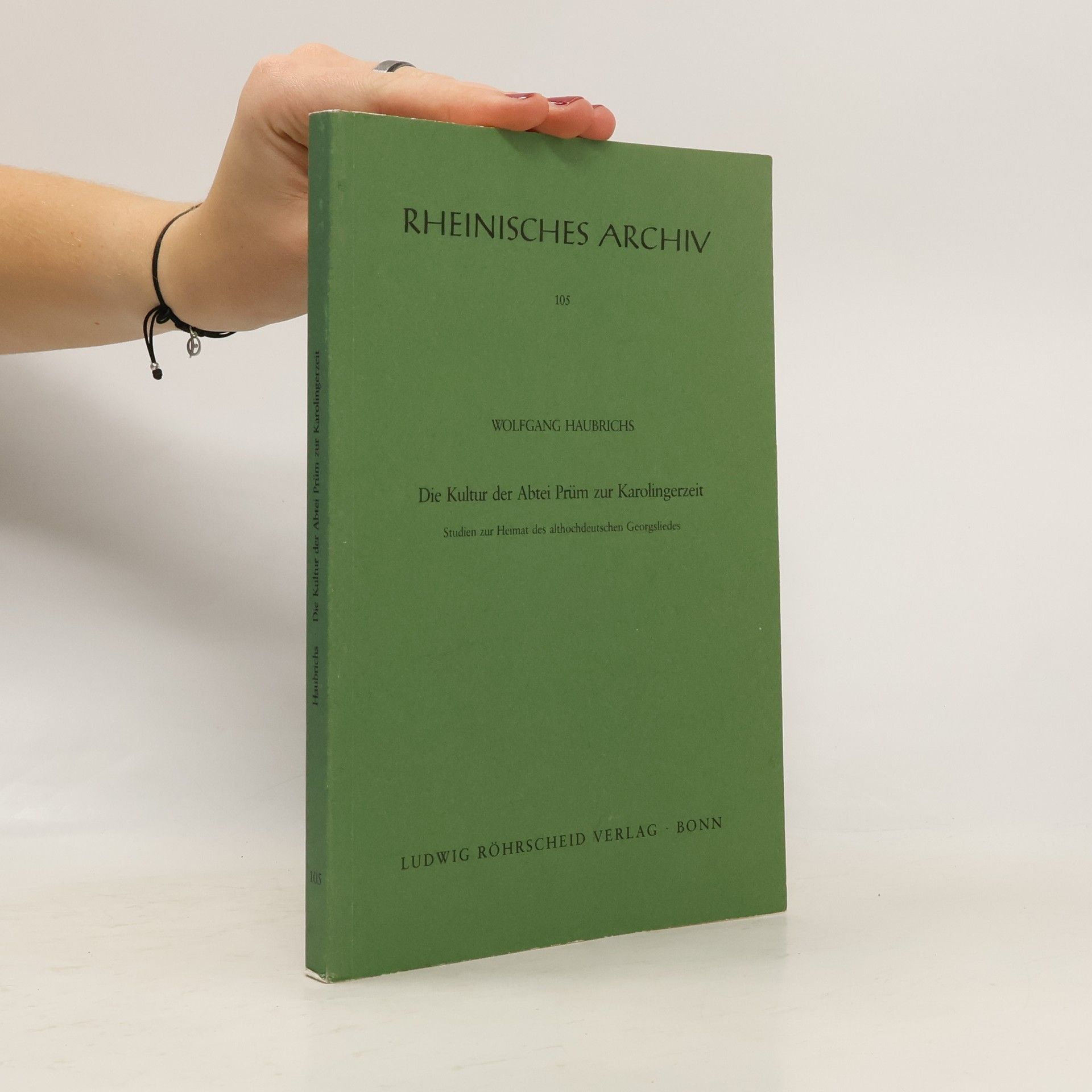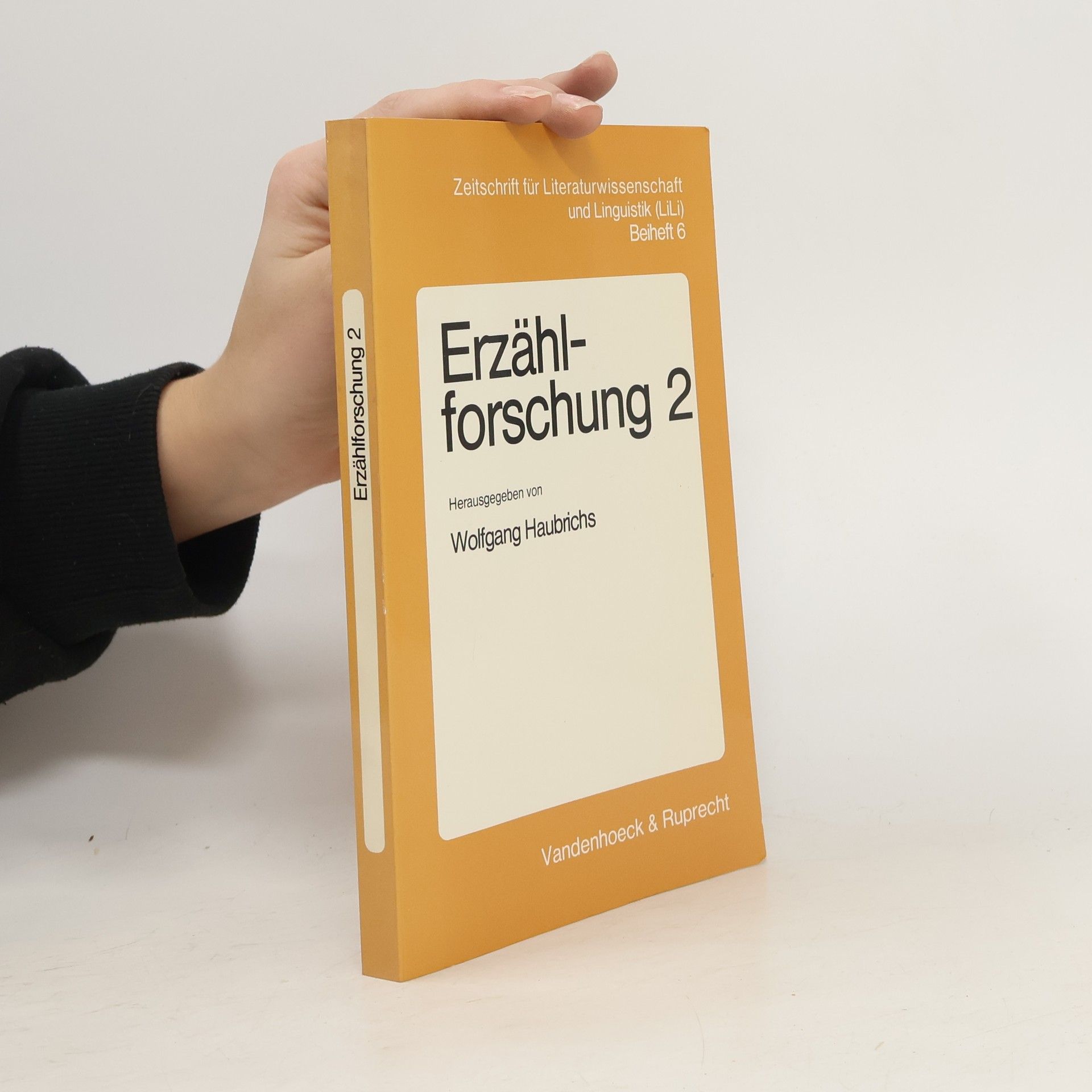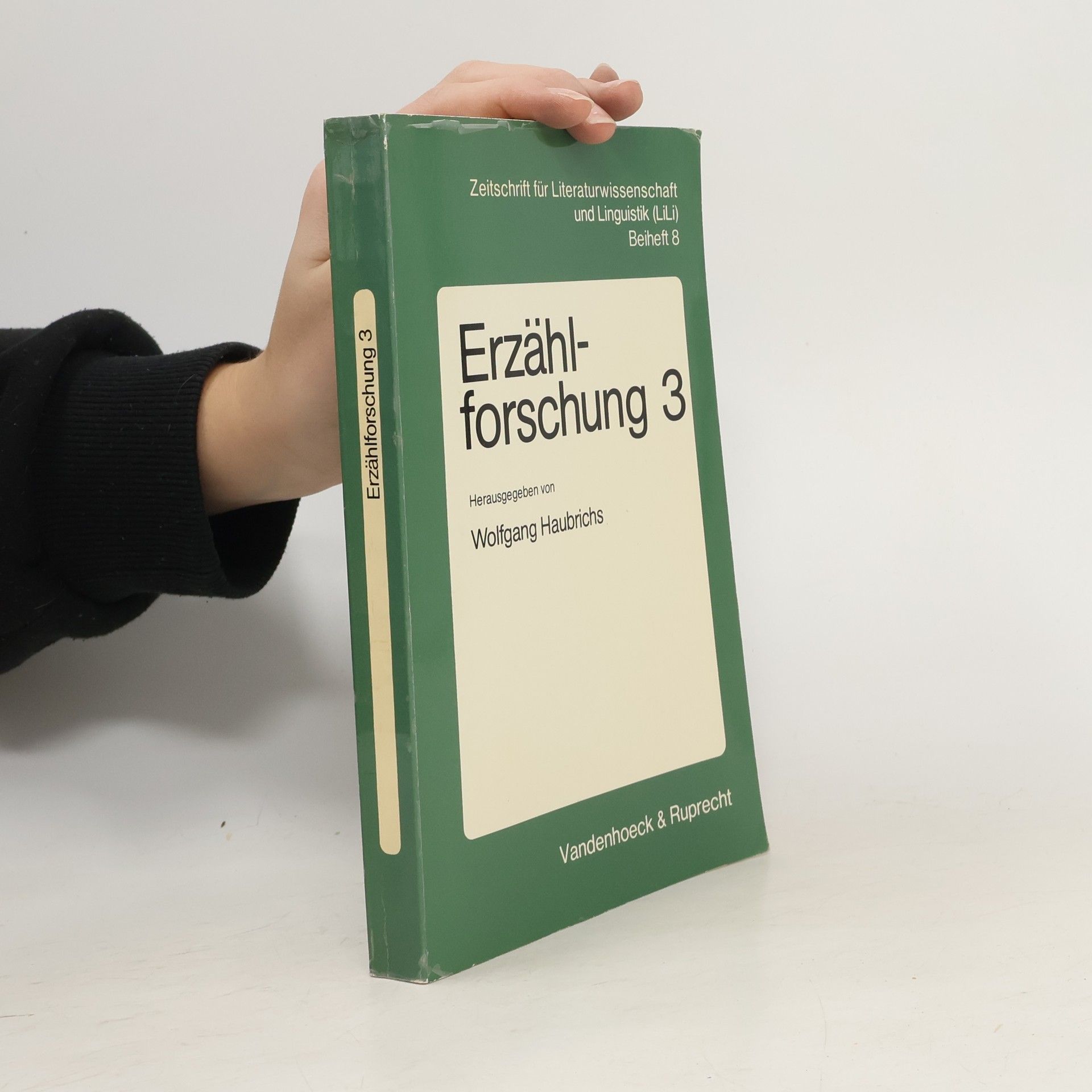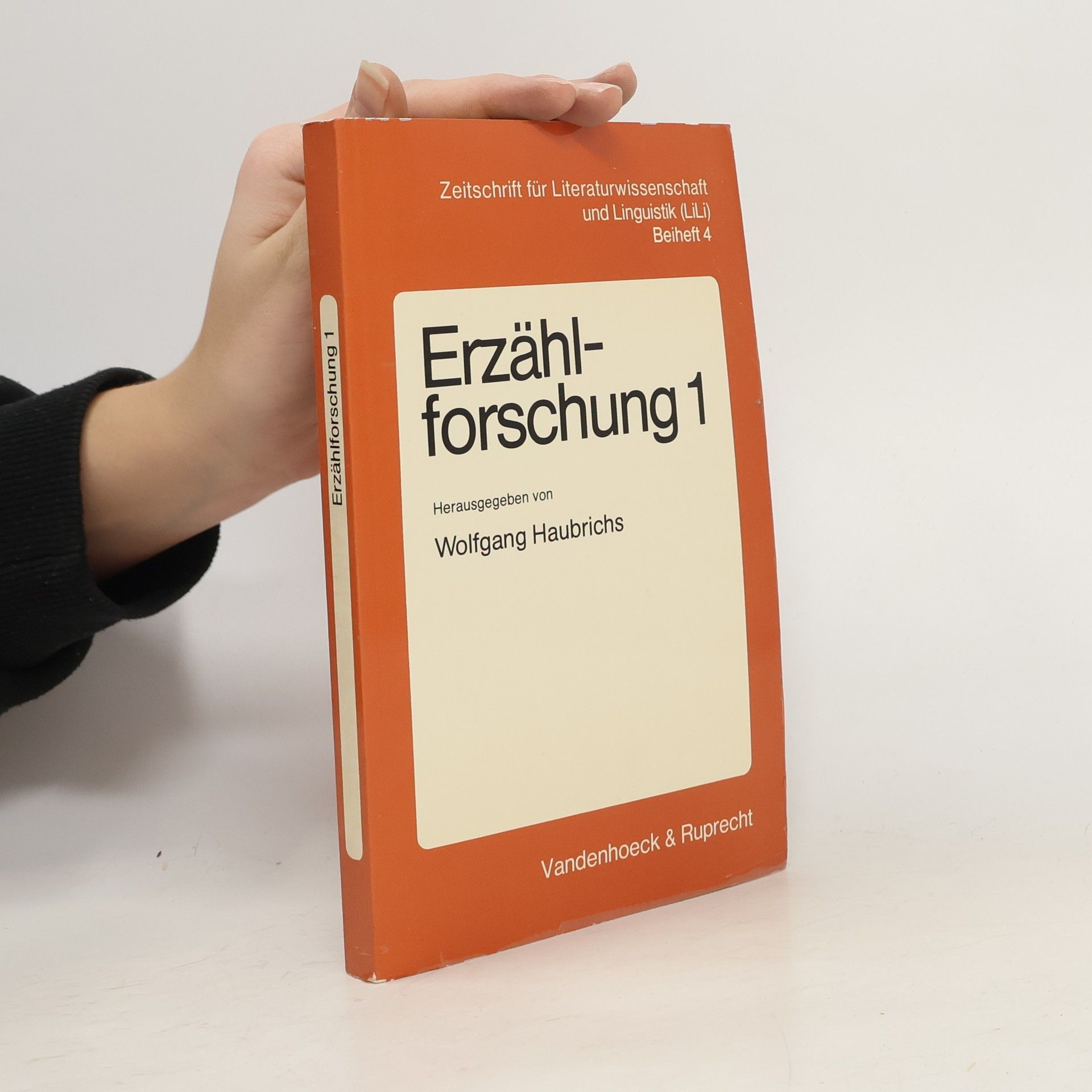Verwaltete Treue
Ein Verzeichnis vereidigter Personen aus dem Norden des "regnum Italiae" zur Zeit Ludwigs II.
- 420 Seiten
- 15 Lesestunden
Die interdisziplinär angelegte Studie untersucht ein Verzeichnis ( breve ) mit den Namen von 174 vereidigten Männern, welches am Ende einer im früheren 9. Jahrhundert in Oberitalien entstandenen, heute im Kloster St. Paul in Kärnten verwahrten Rechtshandschrift eingetragen wurde. Paläographisch-kodikologisch wird die Entstehung des Codex im Kloster Bobbio erwiesen und das darin enthaltene Verzeichnis prosopographisch-onomastisch sowie historisch in der westlichen Emilia situiert, wo seine Aufzeichnung durch die Truppenmobilisierung für einen von König Ludwig II. im Jahr 847 geführten Feldzug gegen die Sarazenen in Süditalien, welche kurz zuvor Rom geplündert hatten, veranlasst war. Die Analyse der Handschrift und des darin enthaltenen Verzeichnisses gewähren wertvolle, in Dichte und Genauigkeit ungewöhnliche Einblicke in die sozialgeschichtlichen Voraussetzungen der karolingischen Herrschaft über Oberitalien, in die Zusammensetzung seiner Bevölkerung, in die Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung dieser durch Rechtspluralität bestimmten Region, in die Anfertigung von kirchlichen und weltlichen Rechtshandschriften sowie in die vorhandenen militärischen Organisationsstrukturen angesichts einer gravierenden äußeren Bedrohung.