Die Vorträge von Martin Heckel, die anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums 2017 gehalten wurden, analysieren die historischen und systematischen Aspekte der Reformation. Sie beleuchten die situativen Einflüsse auf Luthers Äußerungen und die logische Konsistenz seiner theologischen Positionen. Zudem wird die langfristige Wirkung der Reformation auf das deutsche Staatskirchenrecht thematisiert, das sich seit der Weimarer Reichsverfassung von 1919 zu einem säkularen, pluralistischen System entwickelt hat, welches religiöse Vielfalt schützt.
Martin Heckel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
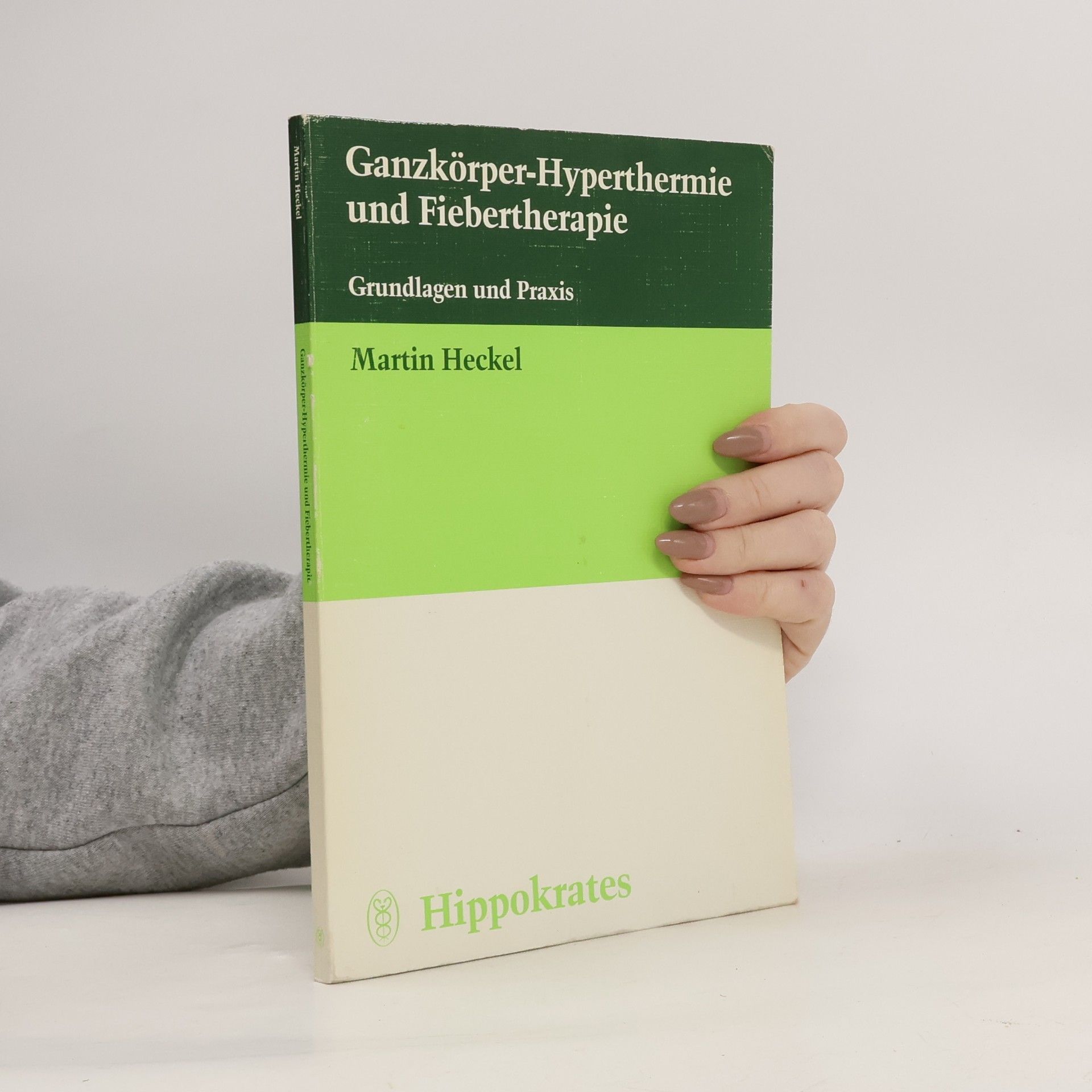
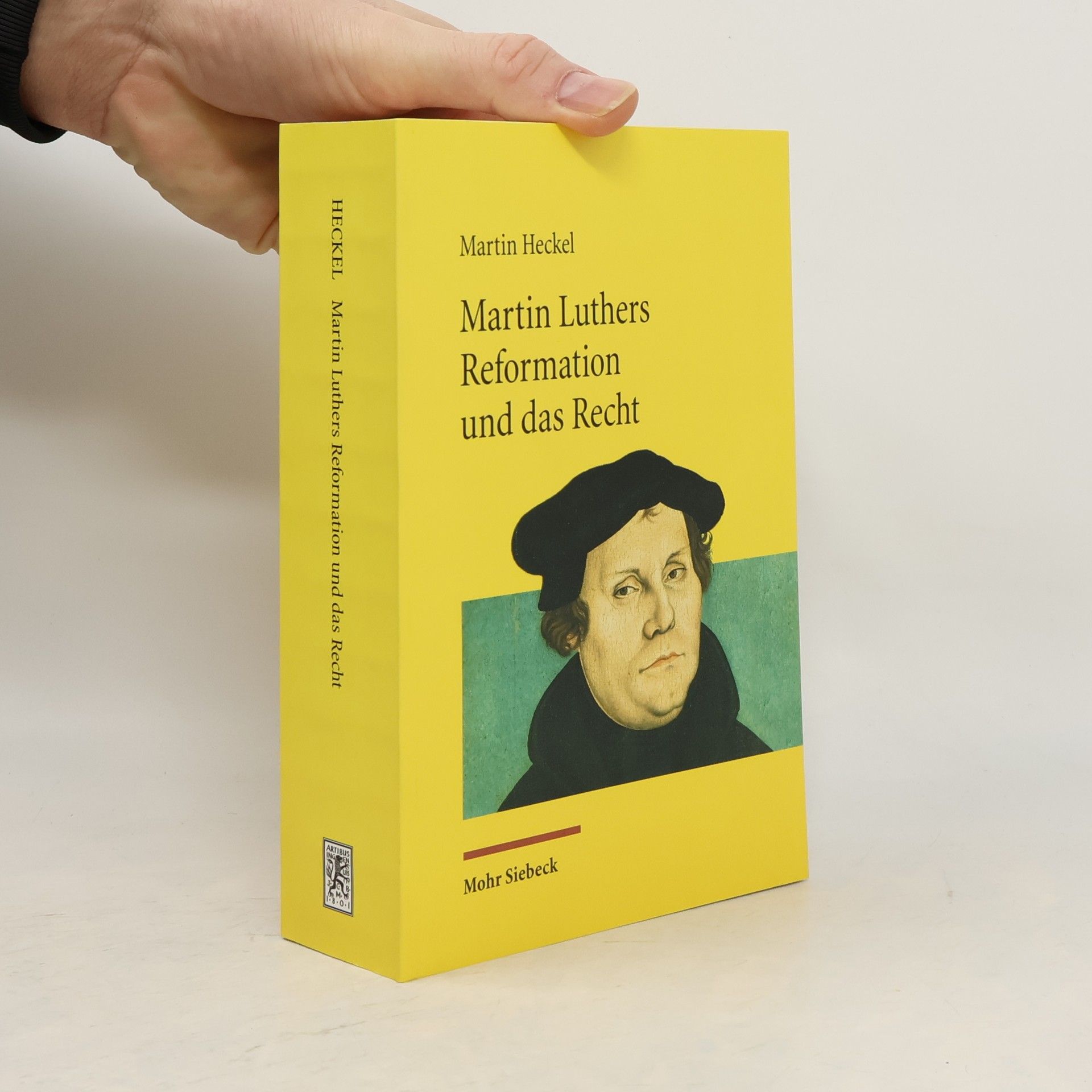

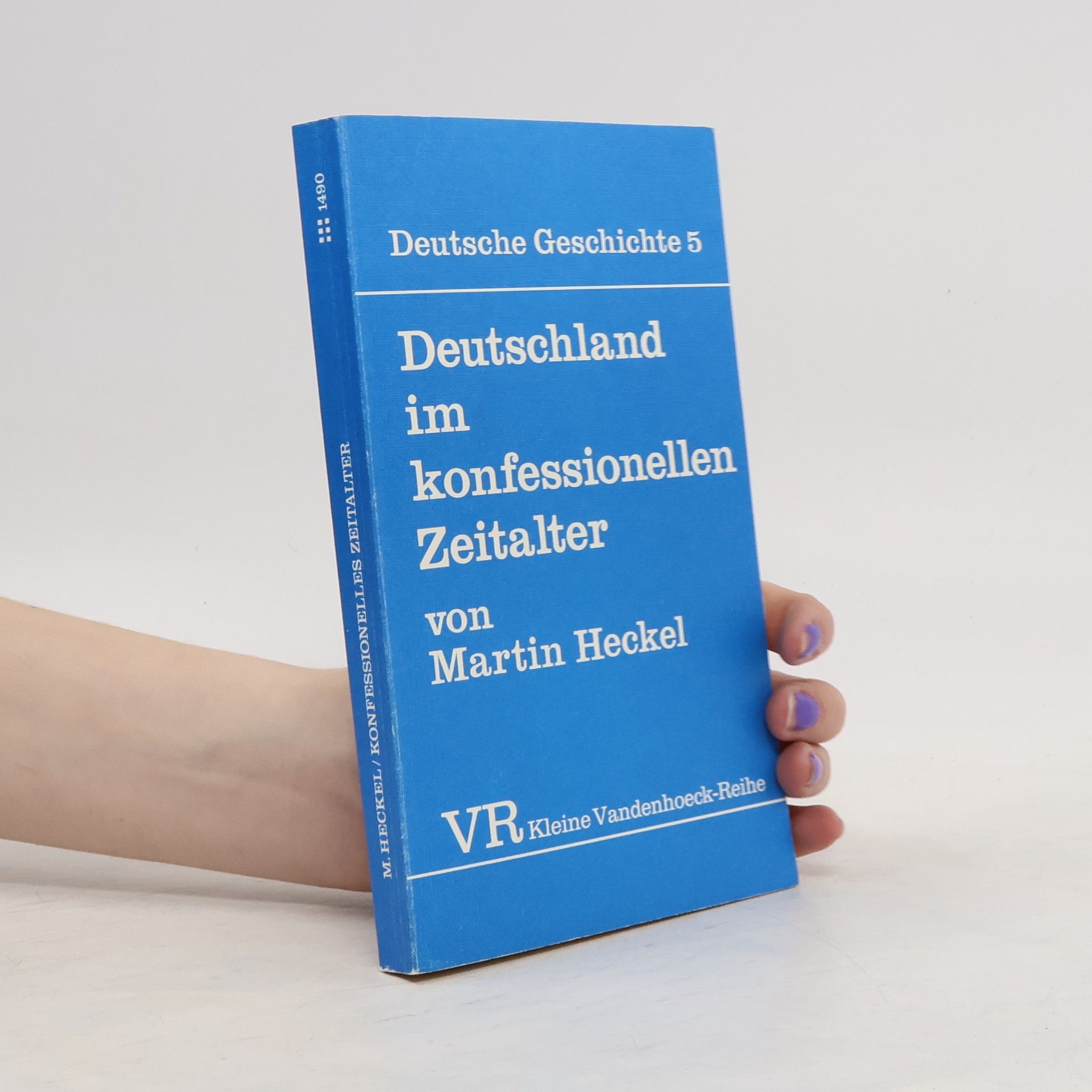
Martin Luthers Reformation und das Recht
Die Entwicklung der Theologie Luthers und ihre Auswirkung auf das Recht unter den Rahmenbedingungen der Reichsreform und der Territorialstaatsbildung im Kampf mit Rom und den "Schwärmern"
Die Entwicklung des evangelischen Kirchenrechts und des Staatskirchenrechts in Deutschland seit Beginn der Reformation ist nur aus der steten Wechselwirkung der juristischen Probleme und Dynamik mit ihren theologischen und politischen Ursachen und Folgen zu erfassen. Erst durch ihre Umsetzung in Rechtsformen führen die geistigen und gesellschaftlichen Kräfte und Bewegungen zur umwälzenden Veränderung oder beharrlichen Verfestigung ihrer Epoche. Durch seine rechtshistorischen Aspekte und Analysen will dieses Werk auch den theologischen und historischen Nachbardisziplinen dienen, auf deren Vorarbeiten es fußt. Es ist problemgeschichtlich ausgerichtet. Es sucht die Entstehung und Wandlung der rechtlichen Institutionen aus den geistlichen und weltlichen Ursprüngen, die dem modernen Empfinden fremd geworden sind, verständlich zu machen und zugleich das Bewußtsein der Kontinuität zu stärken, die unsere pluralistische Geisteswelt und Rechtsordnung mit ihren geschichtlichen Wurzeln verbindet und bis heute prägt und bedingt. Es erstrebt keine handbuchartige Vollständigkeit. Manche Phänomene werden daher detailliert in Nahsicht, andere distanziert im Überblick behandelt. (Aus dem Vorwort)