Werner Rammert Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

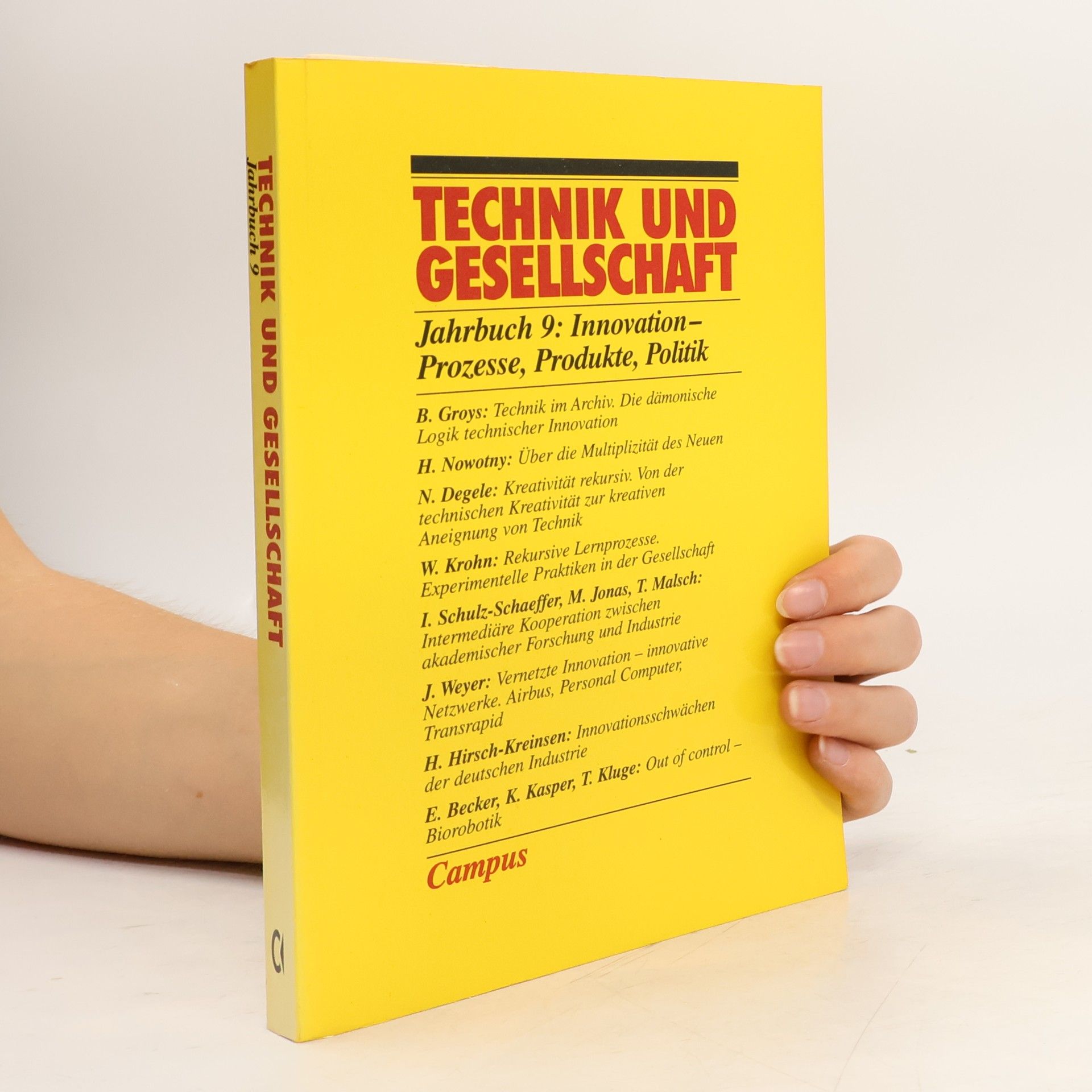
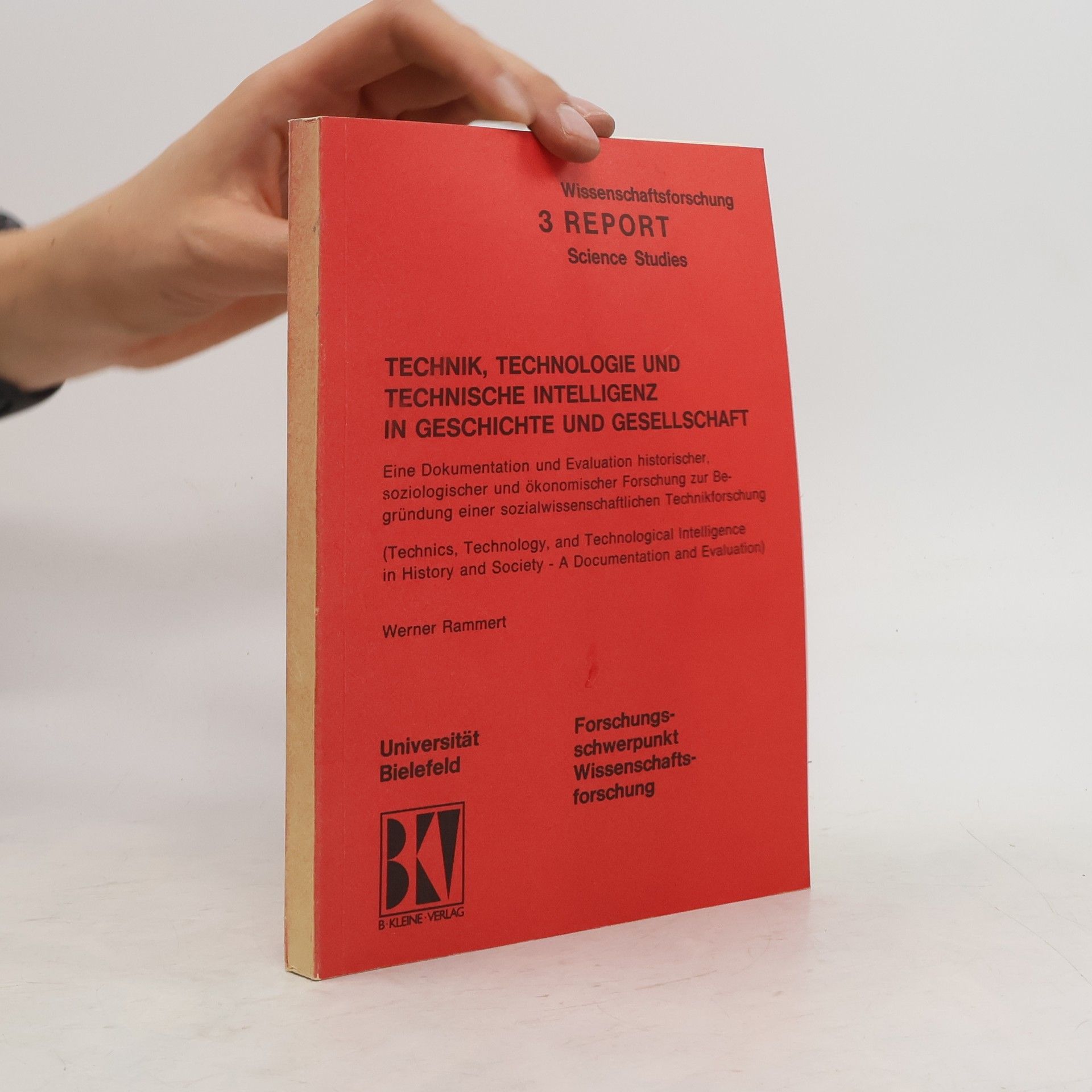
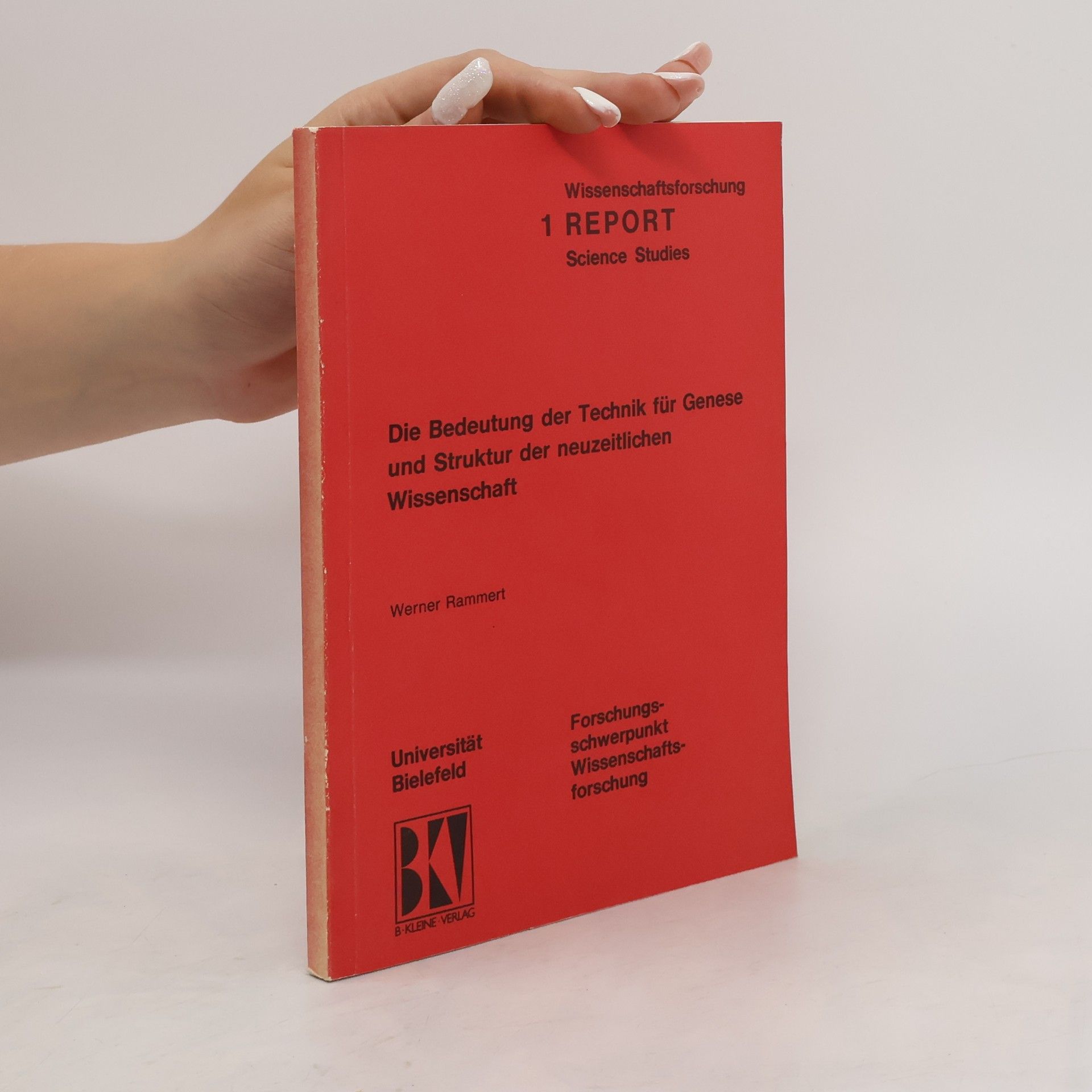
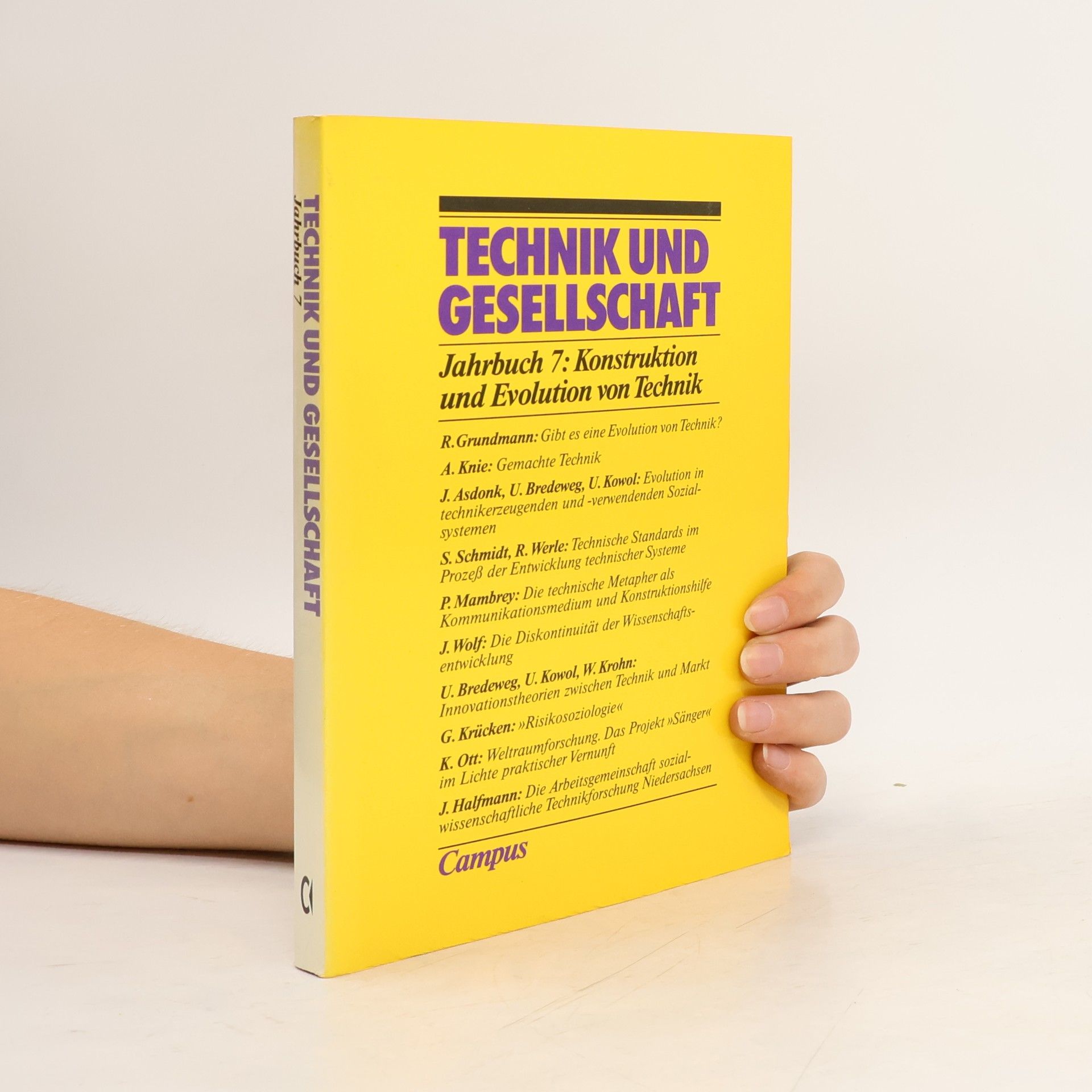
InhaltsverzeichnisVorbemerkung.- I. Prolog.- Computerwelten — Alltagswelten. Von der Kontrastierung zur Variation eines Themas.- Das Programm „Mensch und Technik — Sozialverträgliche Technikgestaltung“. Einige Bemerkungen zu den Projekten im Programmfeld „Alltag und Lebenswelt“.- II. Theoretische Perspektiven.- Computer und andere Dinge. Anstiftung zu soziologischen Vergleichen.- Computer und Mythos. Metaphern eines geregelten Alltags.- Wie kommt es zur Zerstörung zwischenmenschlicher Kommunikation? Überlegungen über längerfristige Tendenzen und die Anwendung von Computern.- Von QWERTY zu WYSIWYG — Texte, Tastatur und Papier.- III. Empirie und Interpretation.- Der symbolische Gehalt einer Technologie. Zur soziokulturellen Rahmung des Computers.- Computer in Familien — Schritte zur Einfügung des Computers in den Alltag.- Der Weg zum „User“. Probleme von EDV-Novizen bei der Aneignung des Phänomens Computer.- Beziehungskiste und Geschlechterdifferenz. Zum Verhältnis der Frauen zum Computer.- Telekommunikation im Verborgenen — Private Mailboxen in der Bundesrepublik Deutschland.- „Computerfreaks sind keine Stubenhocker“. Eine Fallstudie zur öffentlichen Selbstdarstellung von Computerfans.- Die Vergesellschaftung des „persönlichen“ Computers. Gebrauchswert, Sinn und Recht in den Debatten organisierter Akteure.- IV. Epilog.- Zum Stand der Dinge: Die Computerwelt und ihre wissenschaftliche Beobachtung.- Die Autorinnen und Autoren.
Die Bedeutung der Technik für Genese und Struktur der neuzeitlichen Wissenschaft
- 162 Seiten
- 6 Lesestunden