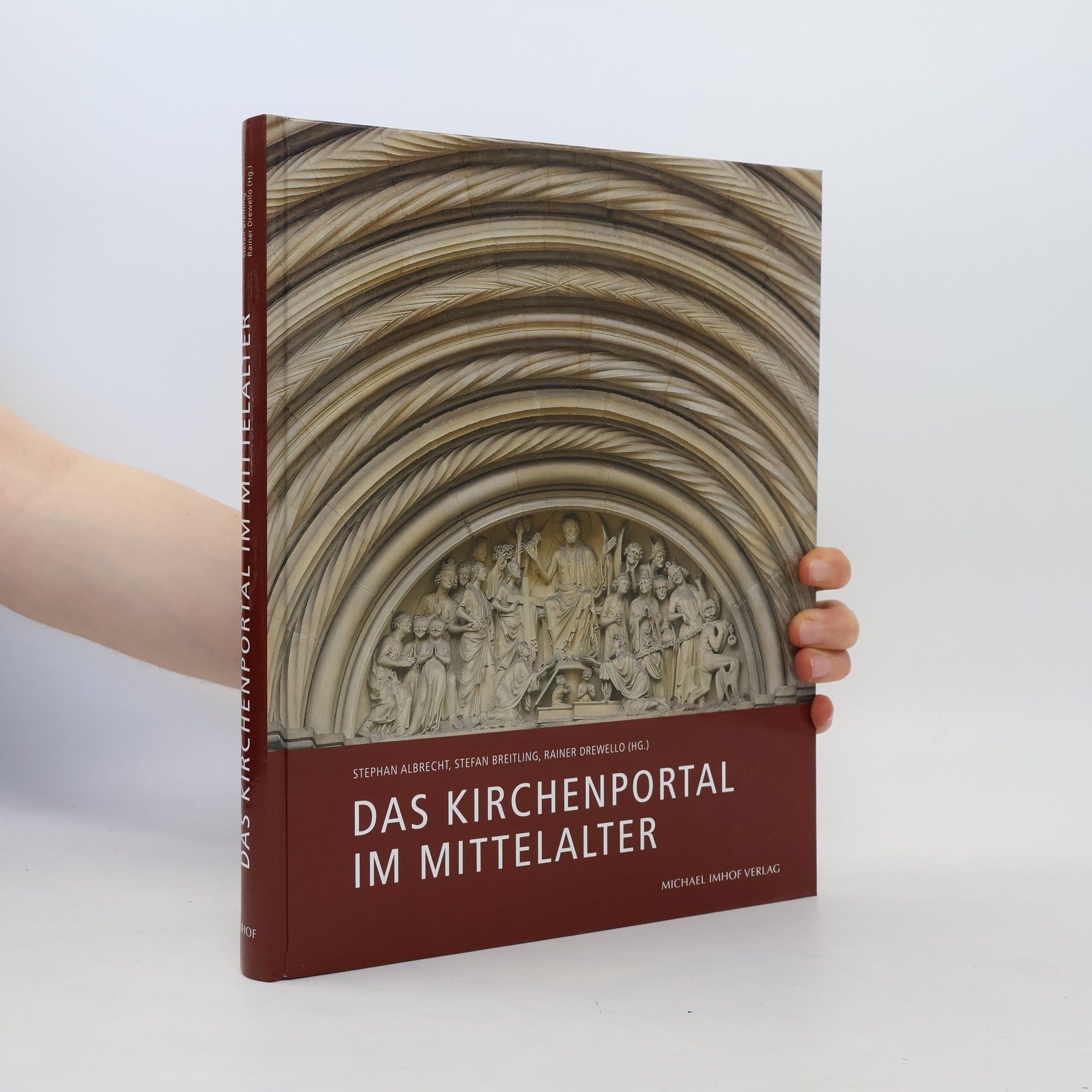Die Querhausportale der Kathedrale Notre-Dame in Paris
Architektur – Skulptur – Farbigkeit
- 248 Seiten
- 9 Lesestunden
Mitte des 13. Jahrhunderts erhielt die gerade erst fertiggestellte Kathedrale Notre-Dame in Paris neue Querhausfassaden mit aufwendigen Figurenportalen. Diese gut erhaltene Architektur und Skulptur verrät viel: über die Experimentierfreudigkeit der mittelalterlichen Baumeister, aber auch über den denkmalpflegerischen Umgang mit dem Mittelalter im 19. Jahrhundert. 0Mit neuen Methoden und Fragen hat ein Forscherteam der Universität Bamberg dies über mehrere Jahre untersucht. Der vorliegende Band legt die Ergebnisse dieses wissenschaftlichen Austausches vor. Wie können wir uns die Planungs- und Ausführungsprozesse dieser herausragenden Pariser Bauhütte vorstellen? Was sagt das Bildprogramm über das Selbstbild seiner geistlichen Auftraggeber aus? In welchem Verhältnis steht die Ikonografie zum Portal, dem Ort der Anbringung? Wie hat sich das Erscheinungsbild der Portale bis heute verändert.