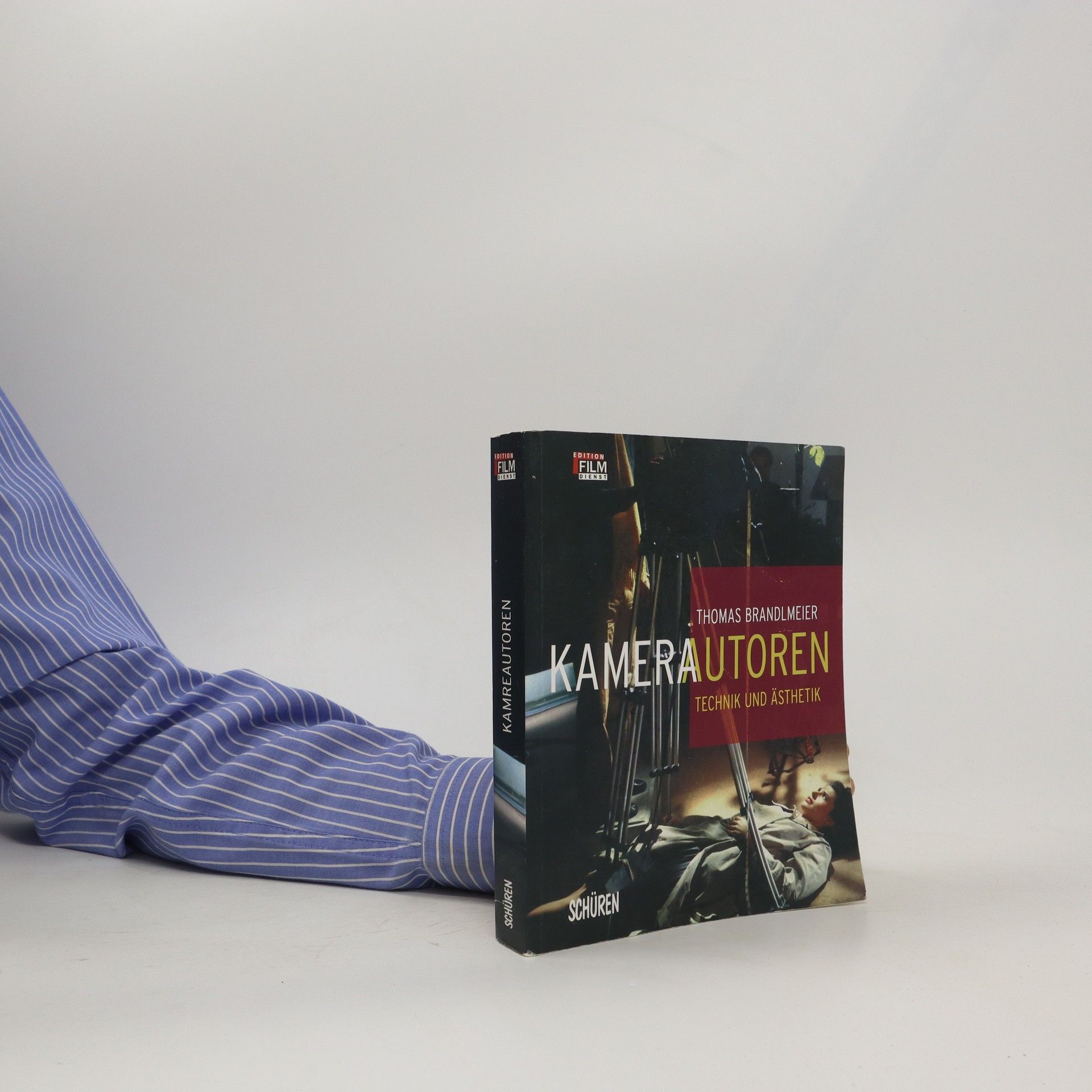Der französische Film
- 242 Seiten
- 9 Lesestunden
Das französische Kino war für die internationale Filmgeschichte von Anfang an zentral und prägend. Bis heute gilt Film in Frankreich als nationales Erbe, das mehr als in anderen Ländern gepflegt und gefördert wird. Große Namen sind damit verbunden: die Brüder Lumière, Georges Méliès und Alice Guy, die Unternehmer Gaumont und Pathé, große Komiker wie Tati oder Louis de Funès, die frühe und späte Nouvelle Vague mit Agnes Varda, Jean-Luc Godard, Francois Truffaut und anderen, Blockbuster-Regisseure wie Mathieu Kassovitz und Luc Besson – und, vor allem seit der Jahrtausendwende, eine Welle innovativer Regisseurinnen wie zuletzt Julia Ducournau. Der Band bietet einen ebenso umfassenden wie subjektiven Überblick: eine Filmgeschichte als Geschichte, im Sinne von Godards "Histoire(s) du Cinéma", ein populärwissenschaftlicher Parforceritt für alle, die die Liebe zum französischen Kino teilen.