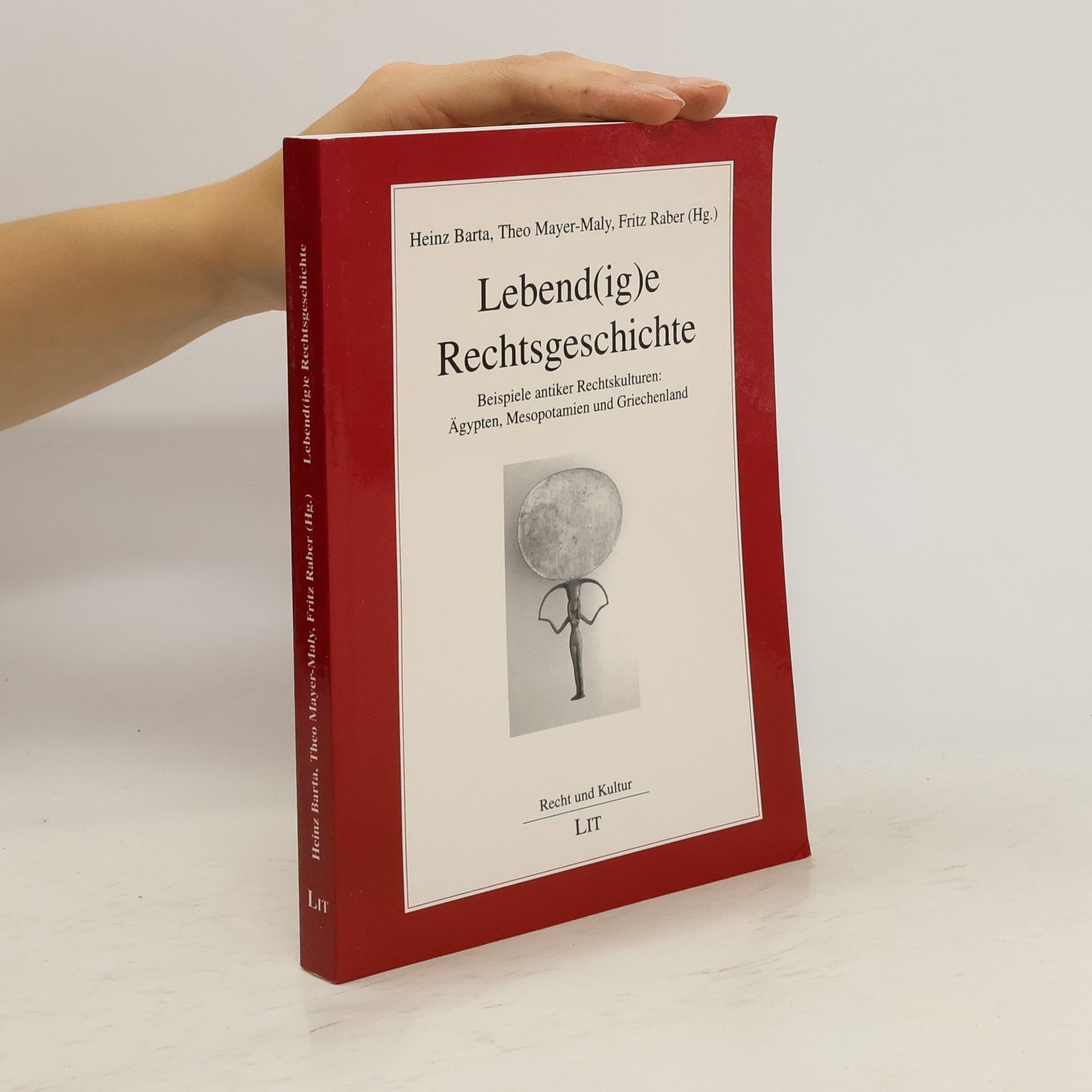Demokratie als kulturelles Lernen
Der politisch-rechtliche Hintergrund des Entstehens von Demokratie im antiken Griechenland
In diesem Band geht es um das Entstehen der Demokratie im antiken Griechenland, wobei die übliche rechts- oder althistorische Behandlung antiker Fragen um F. Braudels Geschichtsphilosophie ergänzt und mit jüngsten Ergebnissen der Evolutionsbiologie (E. O. Wilson und M. Tomasello) verknüpft wird. Berücksichtigt wurde auch E. Flaigs ›Mehrheitsentscheidung‹, die einen bisher wenig beachteten Aspekt in die (Rechts)Geschichte einbringt. Zudem erschien mir ein stärkeres Betonen der rechtlichen Entwicklung lohnend, weil das Recht – obwohl für die griechisch-kulturelle Entwicklung wichtig – meist übergangen wird. – Dadurch gelangen neue Fragen und Antworten in (Antike)Rechtsgeschichte, Alte Geschichte, Alt-Orientalistik, (Rechts)Soziologie, (Rechts) Philosophie und Politikwissenschaft. Die Darstellung reicht über den thematischen Zusammenhang hinaus und berührt – als Konsequenz des Einbeziehens der Evolutionsbiologie, die sich immer mehr als wissenschaftliche Fundierungsdisziplin erweist – grundlegende Fragen von Geschichte, Recht und Philosophie. – Bezüge zur Gegenwart werden hergestellt.