Französische Literatur in Reclams Roter Reihe: das ist der französische Originaltext – ungekürzt und unbearbeitet mit Worterklärungen am Fuß jeder Seite, Nachwort und Literaturhinweisen. Paris in rund 40 Gedichten von der Renaissance bis heute: das ist zugleich ein Streifzug durch die Geschichte der französischen Metropole, Dokument der sich wandelnden Erfahrung der modernen Großstadt und repräsentativer Querschnitt durch die französische Lyrik aus fünf Jahrhunderten. Französische Lektüre: Niveau B1 (GER)
Klaus Ley Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
1. Januar 1943

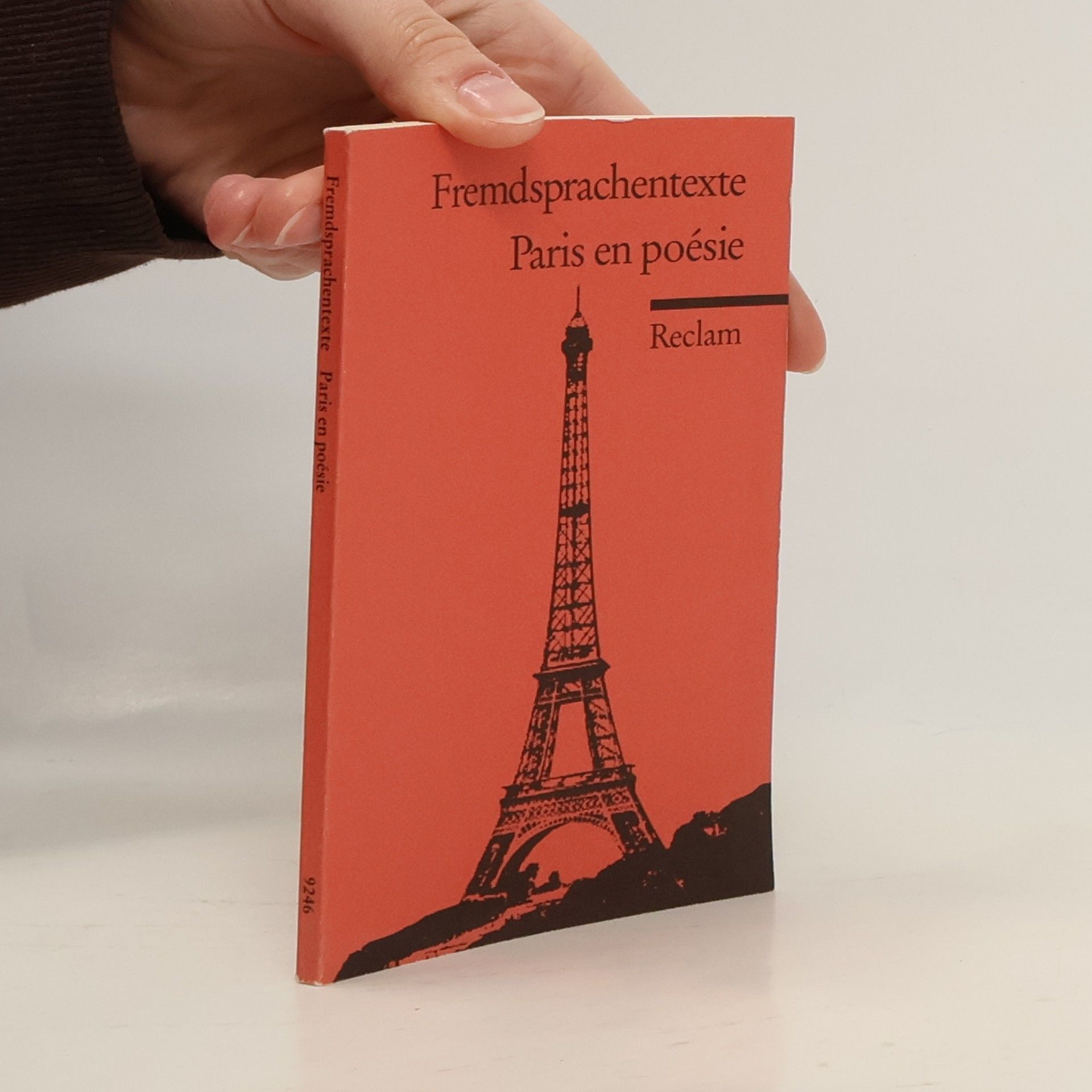
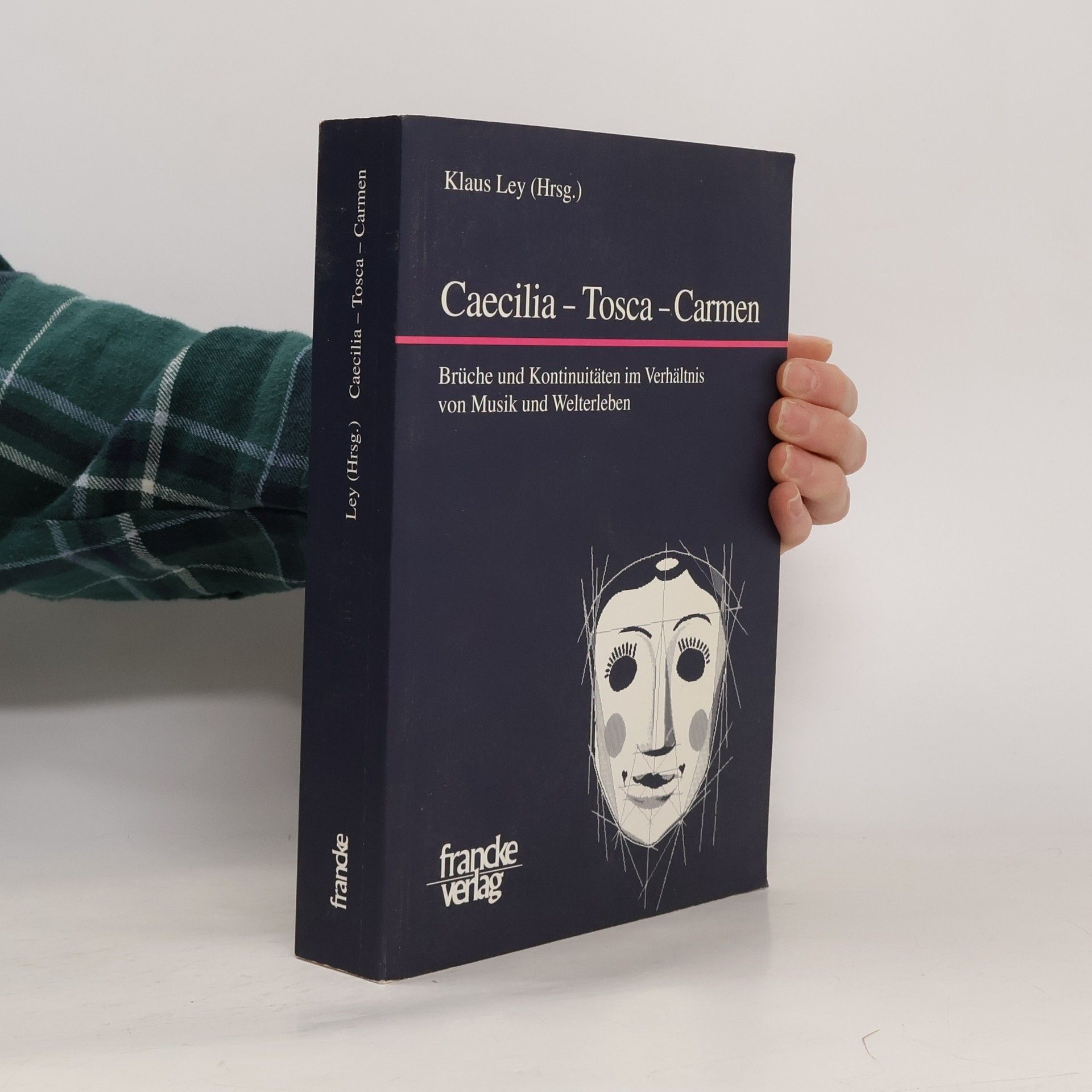
Die Namen der drei im kulturellen Bewusstsein Europas fest verankerten Gestalten markieren Zusammenhänge, die für die Problematik von bildender Kunst, Musik und Dichtung grundlegend sind. In den von einem ausgewiesenen Forscherteam vorgelegten Beiträgen, die hervorragenden Exempla der Grundtypen gewidmet sind, wird die jeweils besondere ZielSetzung analysiert. Darüber hinaus wird die direkte Filiation der mit den unterschiedlichen Namen verbundenen Deutungsmuster herausgearbeitet.