Wie unterscheidet sich ein linkshändiges von einem rechtshändigen U? Wie erkennt man, ob man Schriftsteller oder Maler werden sollte? Worte und Pinselstriche teilen eine gemeinsame Struktur, die durch „Sprachspiele“ (Wittgenstein) und „Malereispiele“ (Lyotard) beschrieben wird. Diese beiden Systeme – Malerei und Literatur – stehen in einem dynamischen Verhältnis zueinander. Johanes Zechner begann mit literarischen Ambitionen, doch seine Begabung für das Zeichnen und Malen führte ihn zur Malerei. Der Linkshänder Jo Hanes, der zum Rechtshänder umerzogen werden sollte, entschied sich letztlich für die Malerei. Dieser Konflikt zwischen den beiden Systemen prägt Zechners Werke und schafft ein komplexes Mischverhältnis, in dem Literatur oft eine zentrale Rolle im Malereibewusstsein spielt. Das Buch gliedert sich in zwei Zyklen: „Emblems from the Bible“ und „Questland“. Der erste Zyklus kombiniert Bibelzitate (übersetzt von Peter Waterhouse) mit gestischer Malerei, während der zweite ausschließlich malerische Gestaltung ohne Schrift umfasst. Beide Zyklen reflektieren Selektionsprozesse, wobei die Zitate aus historischen Texten stammen und die Malerei sich aus den Elementen der gestischen Malerei konfiguriert. Diese ästhetischen Elemente tragen Informationen und sind zeichenhaft, ähnlich wie Buchstaben. Zechner betont die Kongruenz zwischen Wort und Bild, die in beiden Zyklen in wechselnden Proportionen existiert.
Johanes Zechner Bücher
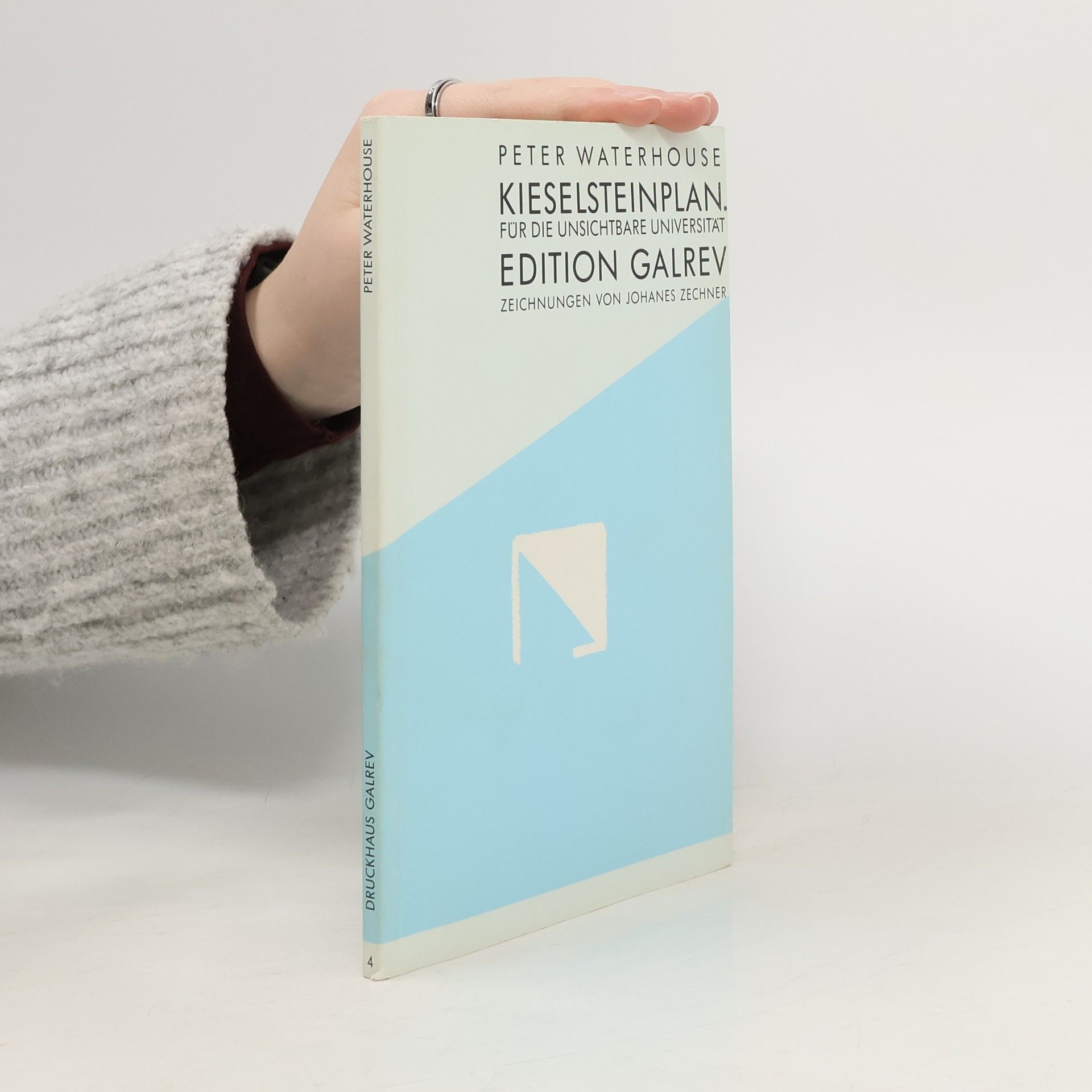

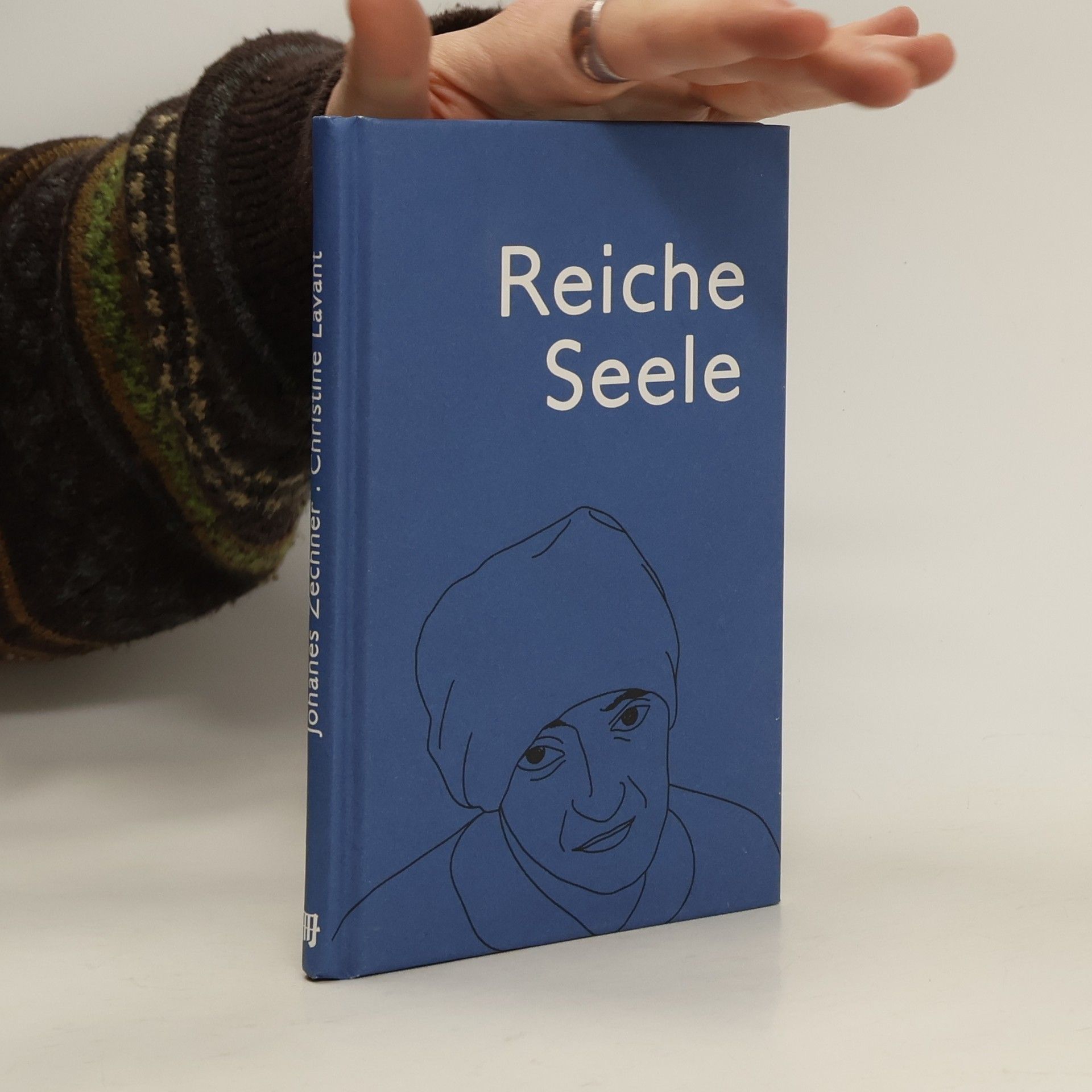

22 Gedichte von Christine Lavant, 40 Zeichnungen von Johanes Zechner, Essay von Walter Fanta. Stellen wir uns einen Bildenden Künstler vor, der nicht so naiv ist wie Johanes Zechner. Wenn er den Auftrag bekäme, aus den Gedichten Bilder zu schaffen, würde er wahrscheinlich die Bedeutung suchen, um sie aufmalen zu können. Möglicherweise würde er einen Literaturwissenschaftler konsultieren, um die tiefere Bedeutung der Gedichte zu entschlüsseln. Doch was könnte ein naiver Maler sonst tun? Er könnte die Oberflächengestalt der Metaphern und Symbole betrachten. Liest er von einem Baum, zeichnet er einen Baum, der das Leben symbolisiert. Liest er von einer Rose, malt er diese und fügt die Liebe hinzu. So naiv ist das gar nicht. Der Maler, der den Auftrag hat, die Schriftbilder der Gedichte in Kunst zu verwandeln, könnte auch weniger naiv sein und sich um die Symbolik nicht kümmern. Doch Johanes Zechner ist noch weniger naiv. Sein Übersetzungsverfahren konzentriert sich auf die Signifikanten, die reine Schriftzeichen. Damit ist er modern, schafft jedoch einen Umgrund, auf dem Bedeutungen andeuten, indem die Signifikat-Ebene in Konturen sichtbar wird. So entsteht etwas Neues. (Walter Fanta)
Edition Galrev: Kieselsteinplan
Für die unsichtbare Universität (Edition Galrev)
- 63 Seiten
- 3 Lesestunden
German