Michael Franz Bücher
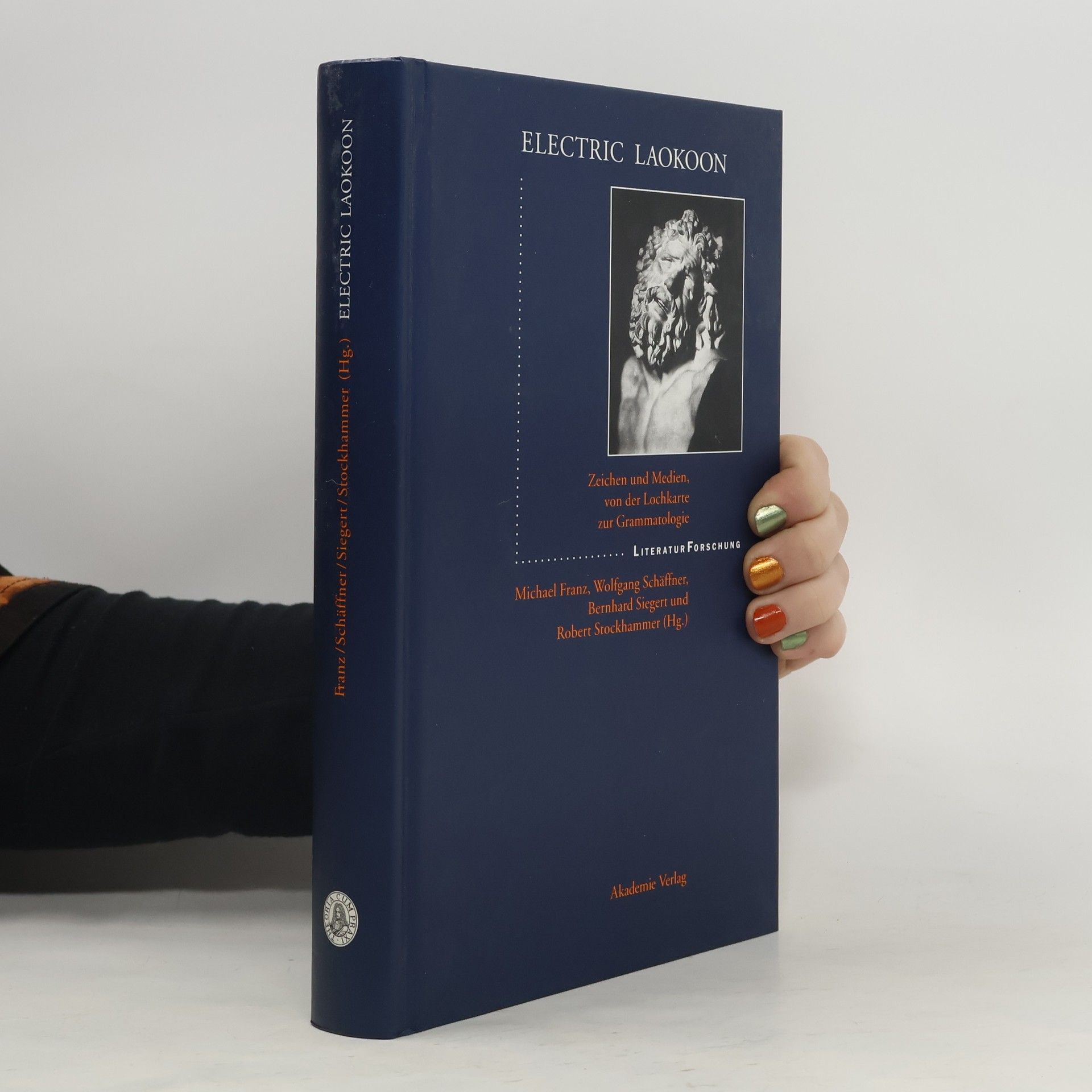
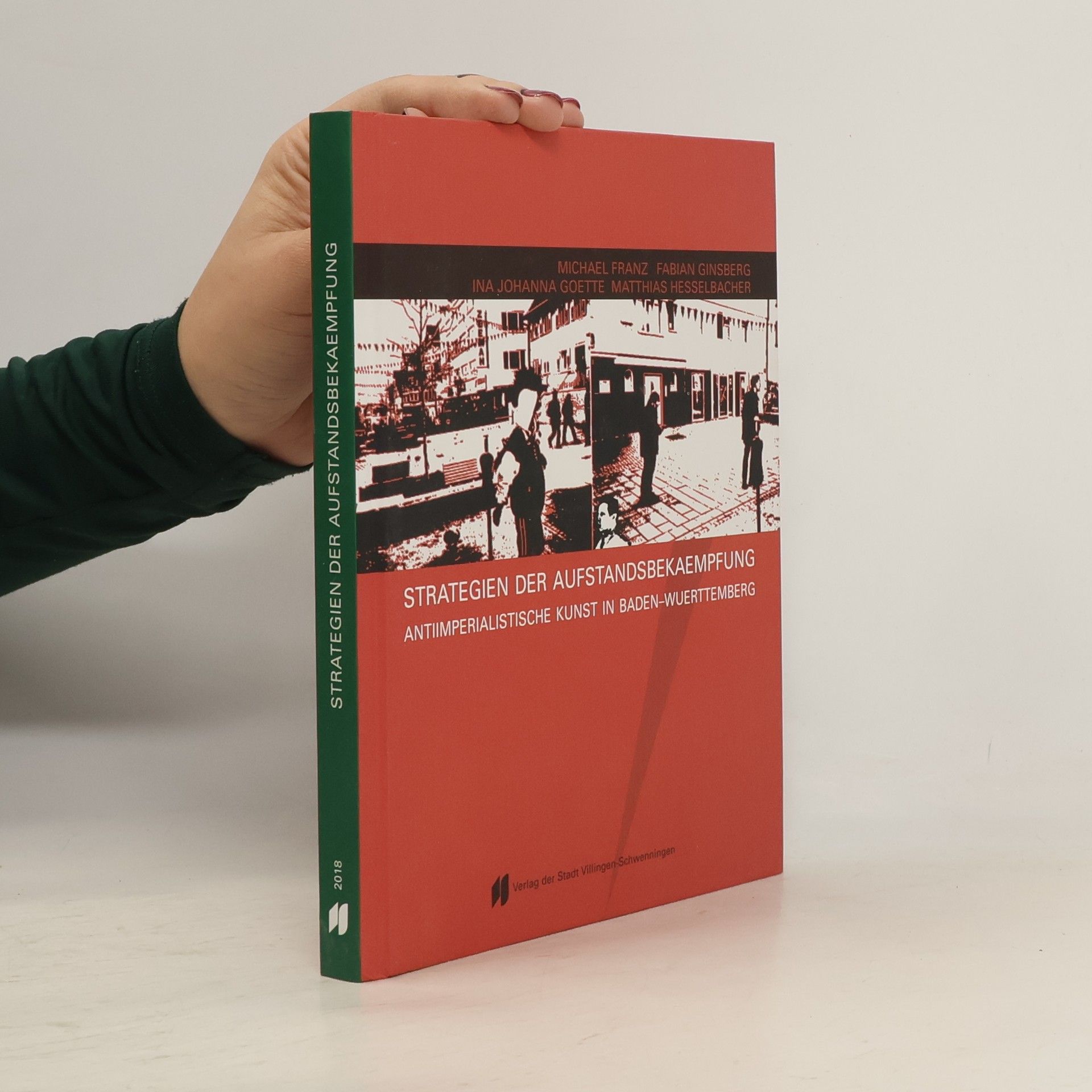



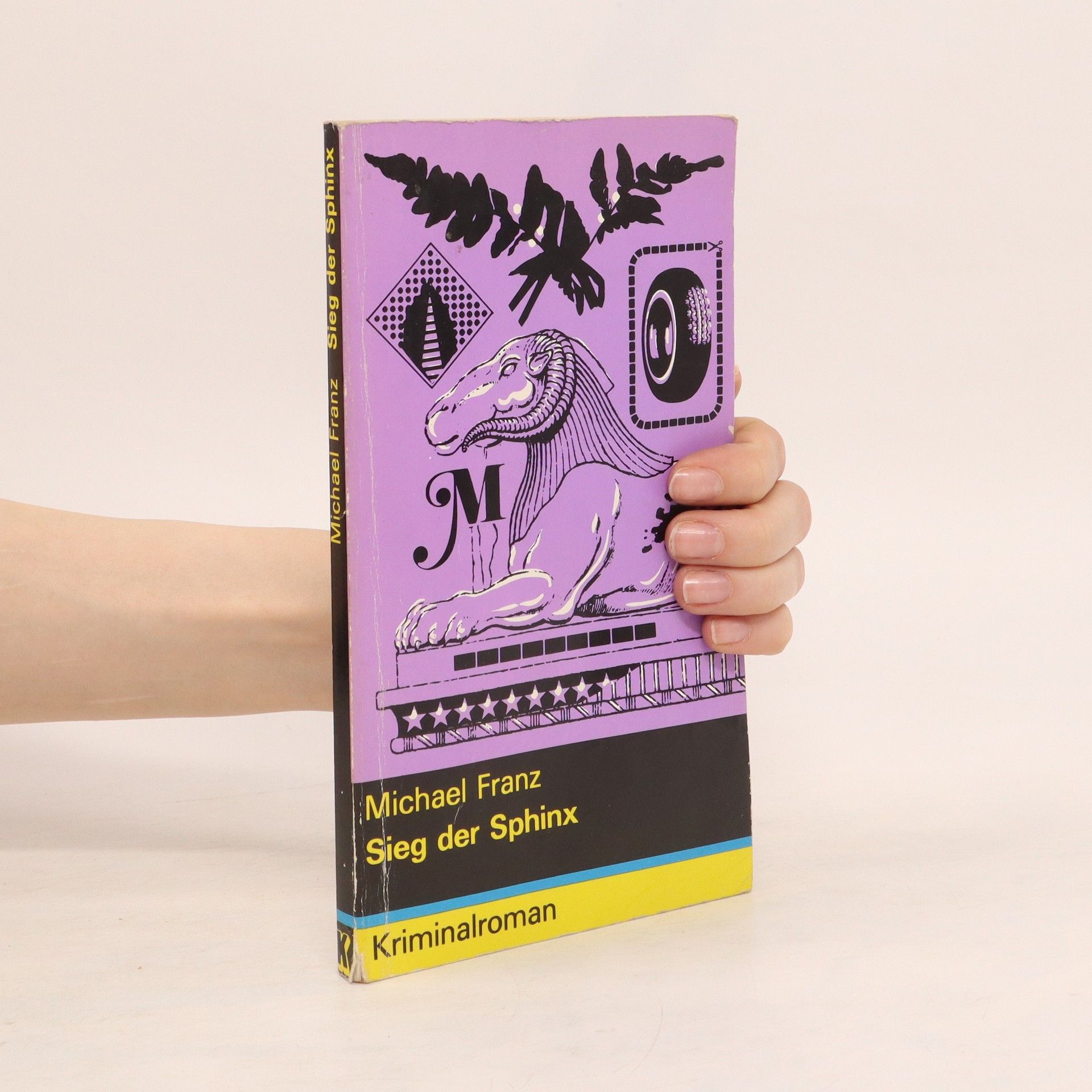
Psychotherapie-Basics in der Psychiatrie
Effektive Interventionen von der Aufnahme bis zur Entlassung
- 240 Seiten
- 9 Lesestunden
Universell: Gesprächstechniken und Krisenmanagement für alle Behandelnden. Konkret: Viele umsetzbare Beispielsituationen. Praxisrelevant: Für alle, die in der Psychiatrie arbeiten. Egal, ob Ärztin, Psychotherapeut oder Pflegekraft – mit den Psychotherapie-Basics gestalten Sie den Kontakt zu Ihren psychiatrischen Patient:innen effektiv, strukturieren Therapiesitzungen und fördern nachhaltige Motivation. Eine Psychologin, ein Mediziner und eine Pflegeverantwortliche haben zahlreiche wirksame Interventionen, Strategien und Haltungen zusammengestellt, die für alle Fachleute in der Psychiatrie von großem Nutzen sind. Pflegekräfte, die rund um die Uhr mit Patient:innen arbeiten, finden hier Techniken für ihren Dienst. Ärzt:innen erhalten Werkzeuge für die Einzeltherapie und Krisensituationen. Psycholog:innen bekommen erleichterten Zugang zum psychiatrischen Arbeiten. Von der Aufnahme bis zur Entlassung bietet dieses Buch direkt einsetzbare Werkzeuge zur Behandlung, einschließlich Krisenintervention, und legt gleichzeitig die Grundlage für planbare Therapien.
Der Roman beginnt mit einem Rundumblick des Papstes im Kreise Vertrauter und endet mit einem Gespräch zwischen dem Kaiser und einem letztlich einzig noch verbliebenen Gefährten aus alter Zeit. Dazwischen geschieht freilich vieles, nicht nur im Leben Friedrichs und seinem Wirken als Herrscher. Vor allem sehen sich Papst und Kaiser zunehmend einer dritten Macht gegenüber: der Macht des aufkommenden Bürgertums.
Ideal zum Nachschlagen, Üben und Lernen! Der komplette Lernstoff in 900 Übungen. Umfassend: In diesem Buch findest Du alle wichtigen Themen der Klassen 5 bis 10, z. B. Zahlen und Größen, Brüche, Dezimalzahlen, Prozentrechnung, Gleichungen, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Geometrie und Sachaufgaben. Leicht verständlich: Alle Themen werden einfach erklärt und mit vielen Beispielen veranschaulicht. Gut portioniert: Für jede Klassenstufe gibt es klar strukturierte Lernportionen. Individuell: Die Aufgaben sind in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt, was ein passgenaues Mathe-Training ermöglicht. Selbst entdecken: Die wichtigsten Mathe-Regeln können abgeleitet, verstanden und sicher angewendet werden. Lerntipps erleichtern das Lernen und weisen auf typische Stolperfallen hin. EXTRA: Auf den letzten Seiten findest Du wichtige Formeln und Rechenregeln im Überblick. Themen im Buch: 5. Klasse: Rechnen mit natürlichen Zahlen, geometrische Grundbegriffe, Text- und Sachaufgaben. 6. Klasse: Teilbarkeit, Prozentrechnung, Winkel, Rechnen mit ganzen Zahlen. 7. Klasse: Dreisatzrechnung, rationale Zahlen, lineare Funktionen, Wahrscheinlichkeitsrechnung. 8. Klasse: Binomische Formeln, Gleichungssysteme, Satz des Pythagoras. 9. Klasse: Quadratische Funktionen, Trigonometrie, Kombinatorik. 10. Klasse: Exponential- und Logarithmusfunktionen, Wahrscheinlichkeiten.
Literatur Forschung: Electric Laokoon
Zeichen und Medien, von der Lochkarte zur Grammatologie
- 378 Seiten
- 14 Lesestunden
Mit Beiträgen von Inge Baxmann, Annette Bitsch, Robert Brain, Bernhard J. Dotzler, Michael Franz , Rodolphe Gasché, Hans-Christian von Herrmann, Ute Holl, Anton Kaes, Alexandre Métraux, Wolfgang Schäffner, Bernhard Siegert und Robert Stockhammer
Skid Kids
- 458 Seiten
- 17 Lesestunden
Loneliness envelops Zander as he ventures out of the Wastelands, grappling with the profound loss of leaving his younger sister, Kensy, behind. As a mutant accustomed to hardship, this separation strikes deeper than any previous experience. In the bustling yet unfamiliar city of Westport, Kensy's words echo in his mind, providing a fragile thread of hope and motivation as he navigates a new and challenging world.
