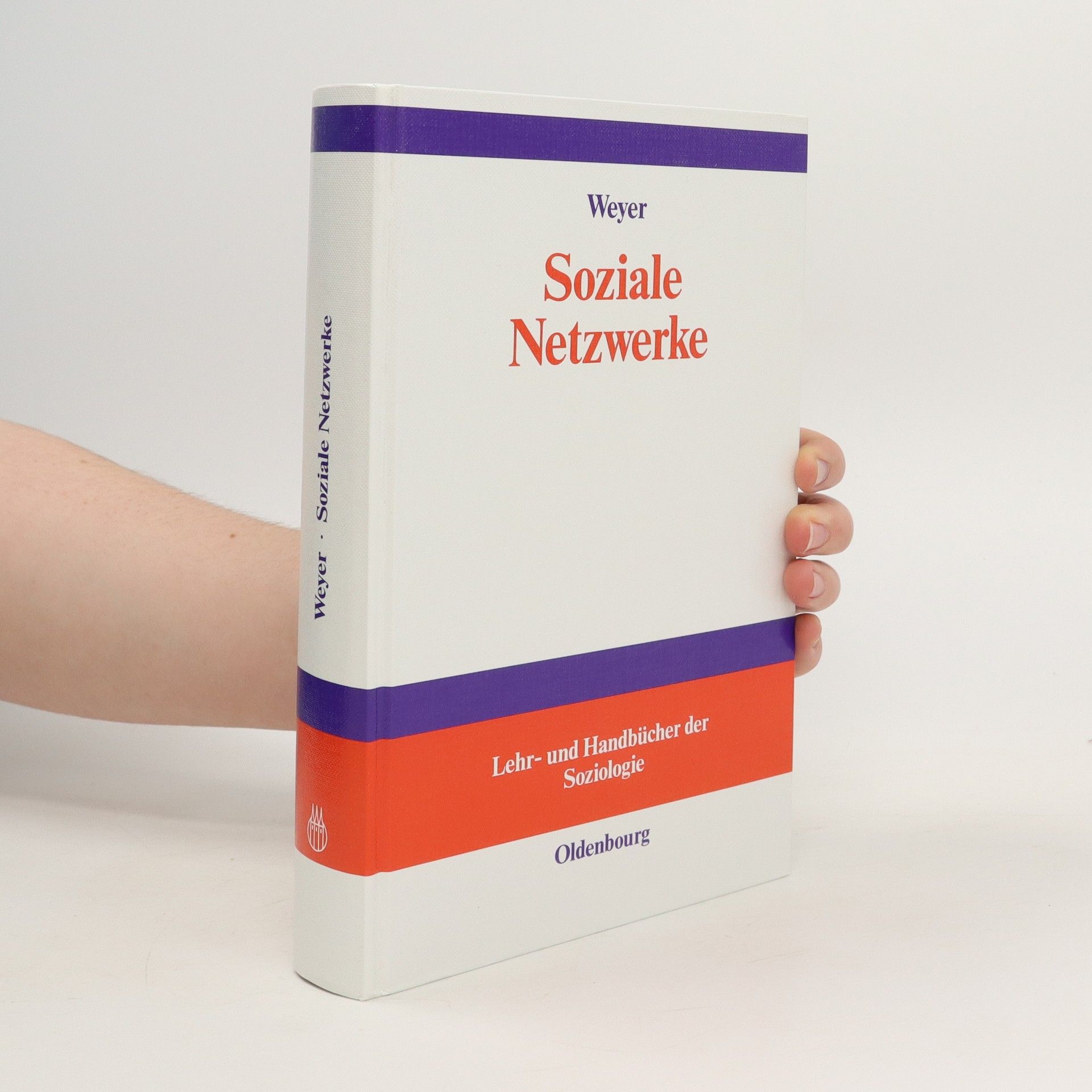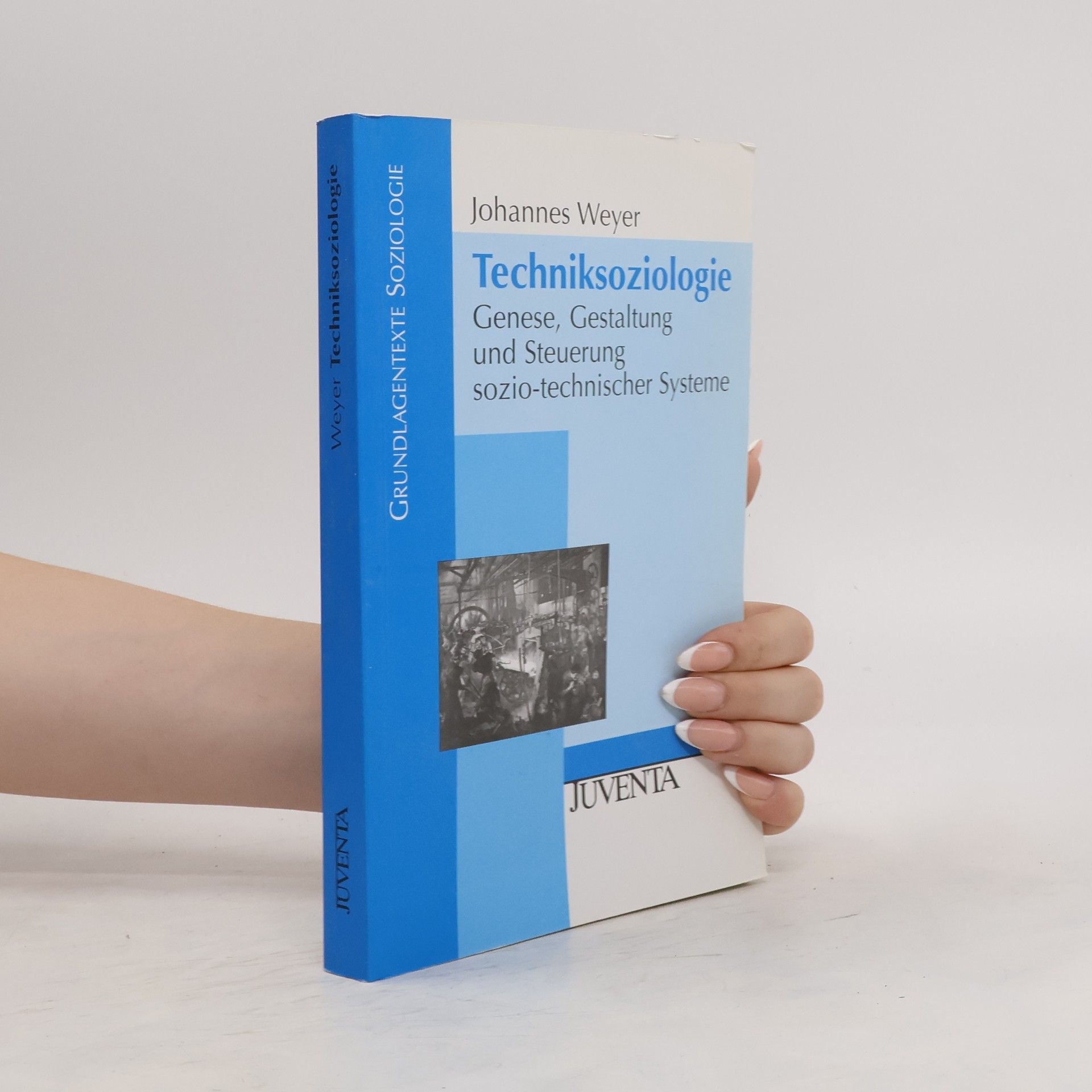Wernher von Braun
- 157 Seiten
- 6 Lesestunden
Wernher von Braun war zeit seines Lebens von dem Traum beseelt, zum Mond zu fliegen und die dafür erforderliche Großrakete zu konstruieren. Um dieses Ziel zu verwirklichen, hat er vorrangig Militärraketen entwickelt, zunächst in Deutschland die «V2», dann in den USA die atomar bestückte «Redstone». Er war bereit, sich in den Dienst verschiedener Mächte zu stellen, wenn diese ihm die Mittel verschafften, die er für die Verfolgung seiner Vision benötigte.