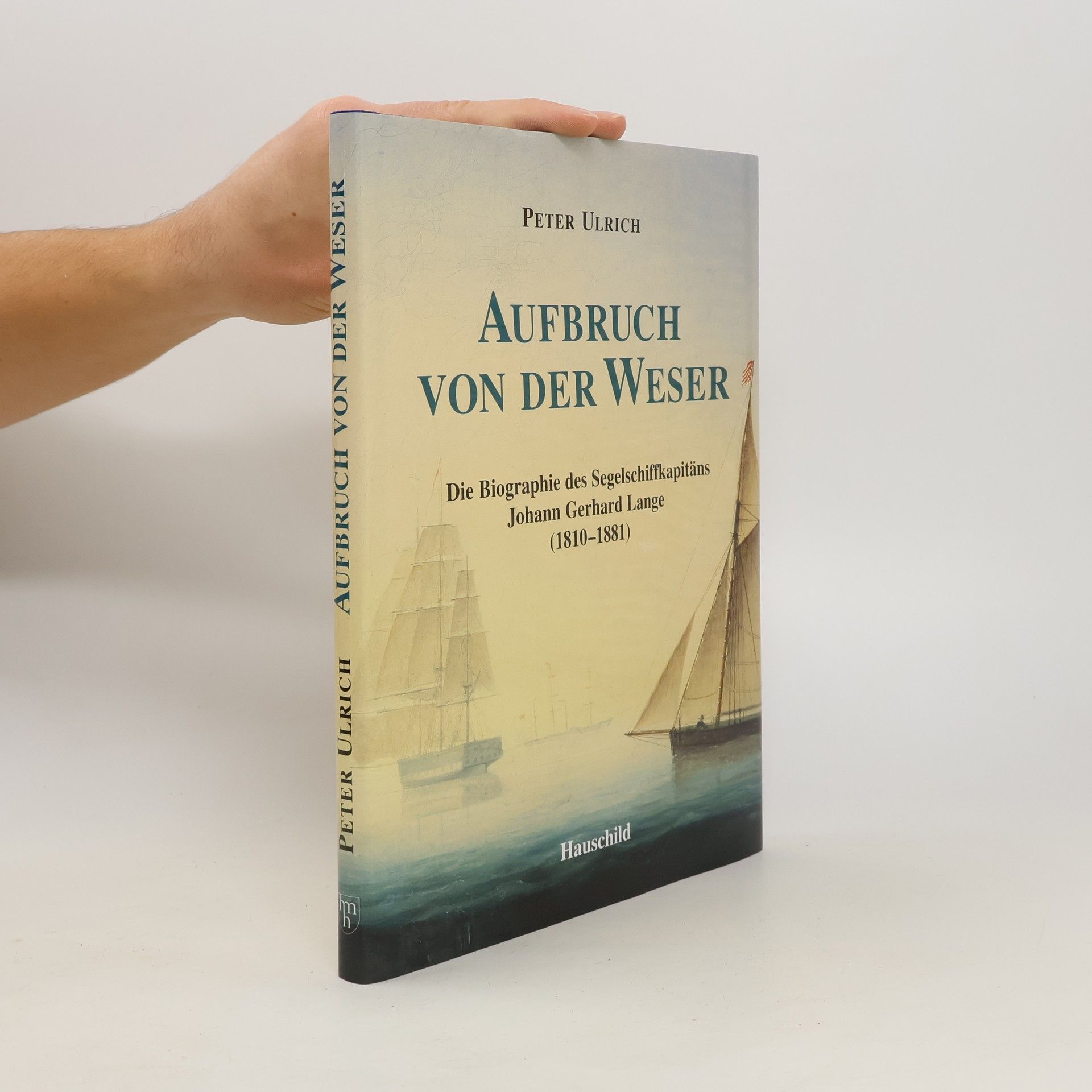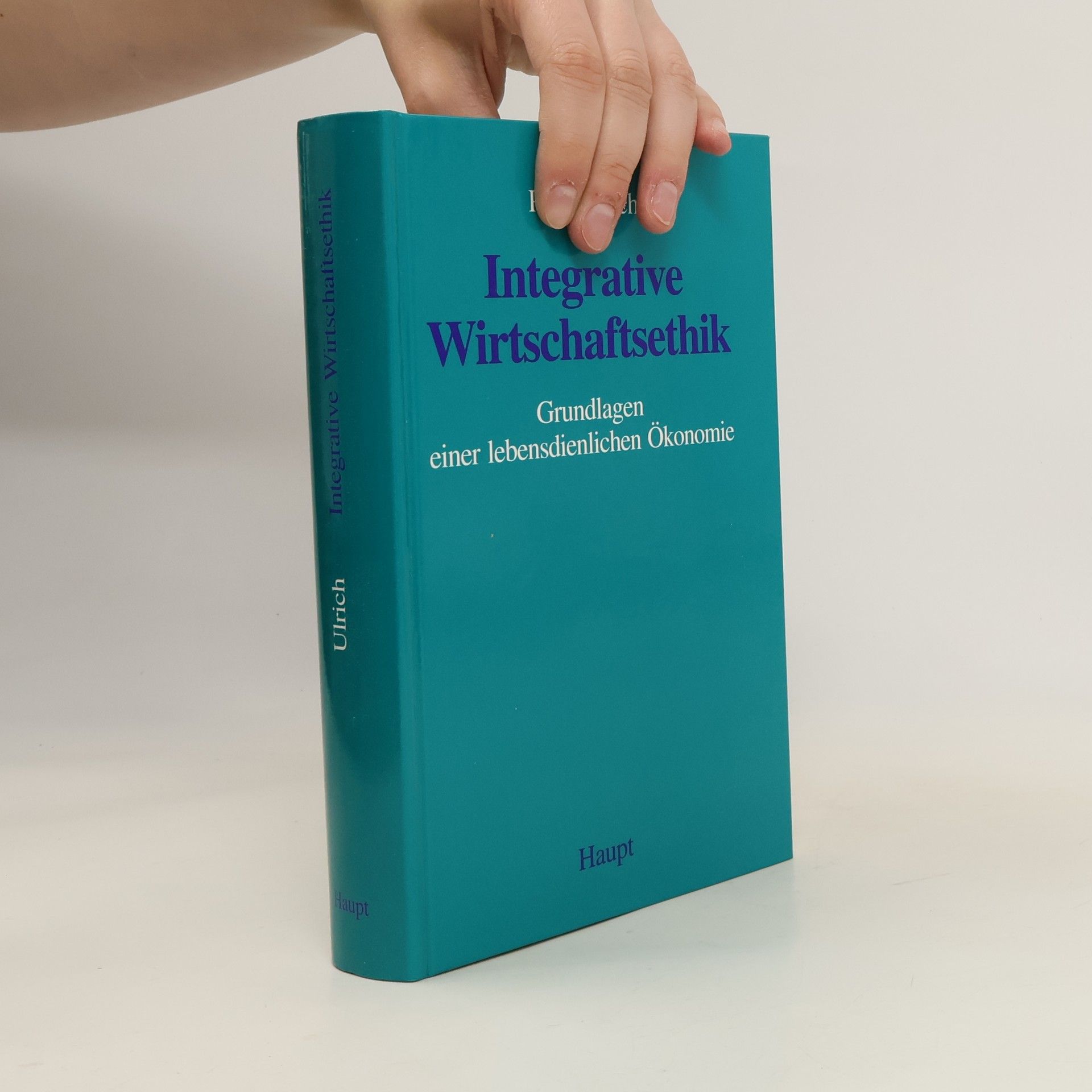Integrative Wirtschaftsethik
- 517 Seiten
- 19 Lesestunden
Die Entstehungsgeschichte dieses Buches beginnt mit der Schaffung des Lehrstuhls für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen im Sommer 1987, dem ersten seiner Art an einer deutschsprachigen Wirtschaftsfakultät. Nach zehn Jahren Entwicklung wird hier erstmals eine systematisch ausgearbeitete Gesamtdarstellung des St. Galler Ansatzes der 'integrativen Wirtschaftsethik' präsentiert. Diese Ethik ist eine philosophische Vernunftethik des Wirtschaftens, die Orientierung im politisch-ökonomischen Denken bietet. Neu ist, dass dieser Ansatz sich nicht nur mit der Verteidigung der 'Moral des Marktes' oder der Rolle als 'das Andere der ökonomischen Sachlogik' befasst. Vielmehr wird das Normative im ökonomischen Denken selbst kritisch beleuchtet und in den Kontext der Fragen des guten Lebens und des gerechten Zusammenlebens gestellt. Die integrative Wirtschaftsethik umfasst drei Grundaufgaben: 1. die Kritik der 'reinen' ökonomischen Vernunft und ihrer Überhöhung zum Ökonomismus; 2. die Klärung der ethischen Gesichtspunkte einer lebensdienlichen Ökonomie; 3. die Bestimmung der 'Orte' der Moral des Wirtschaftens in einer wohlgeordneten Gesellschaft freier Bürger. Diese Perspektive bietet einen wegweisenden Ansatz zur lebensdienlichen Wirtschaftsgestaltung.