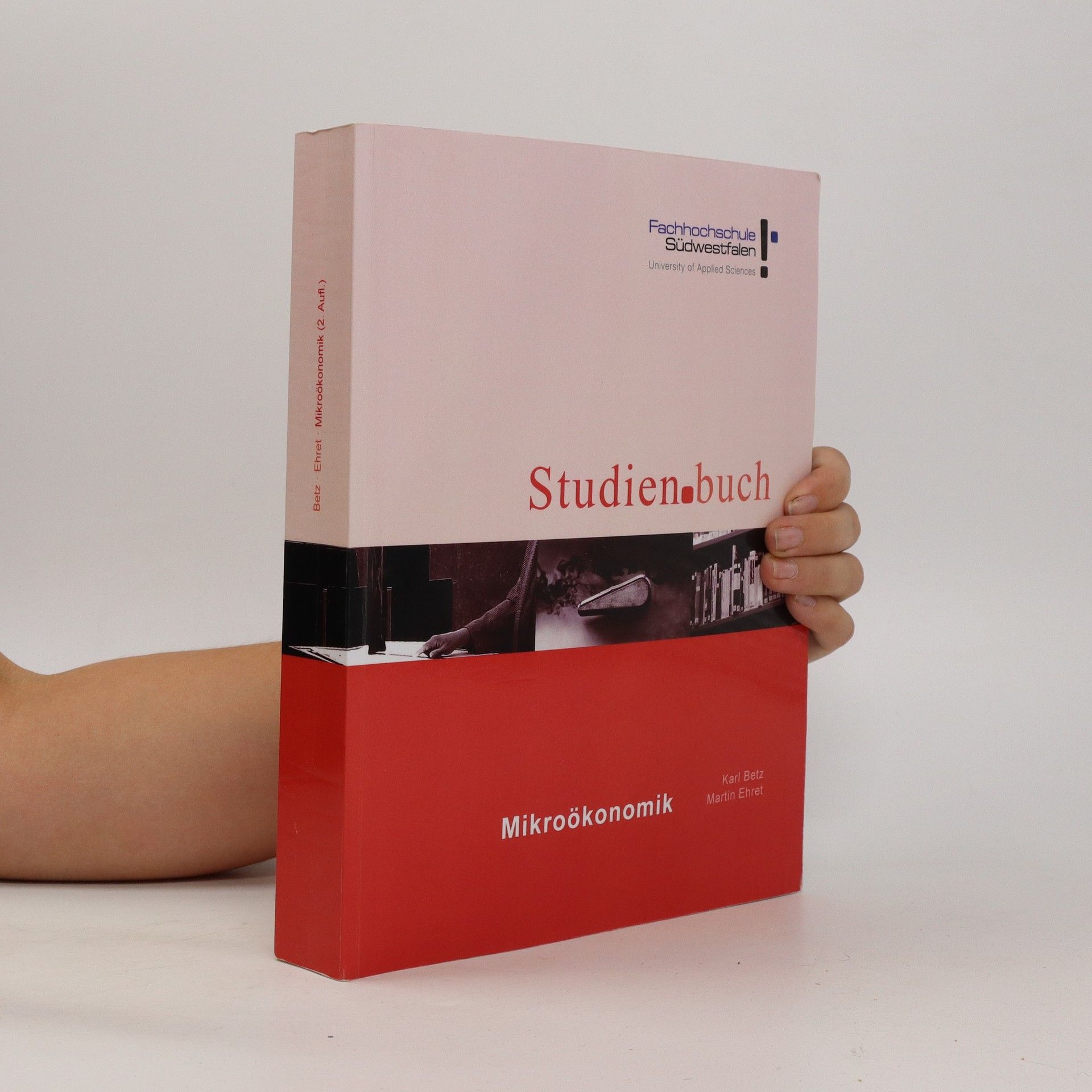Was zusammenklingen soll und was nicht
Richtiges Pedalisieren & künstlerisches Klavierspiel
- 360 Seiten
- 13 Lesestunden
Die Bedeutung des Pedals im Klavierspiel wird in diesem Buch umfassend behandelt, da es entscheidend für den Klang ist und mit dem natürlichen Vibrato anderer Instrumente vergleichbar ist. Häufig werden Pedaltechniken im Unterricht vernachlässigt, was zu falschen Reflexen führt, die nicht mit den klanglichen Anforderungen verbunden sind. Anhand von 315 Beispielen werden typische Pedalfehler analysiert, wobei das Buch darüber hinaus die Wechselwirkung zwischen Fingern und Füßen beim Spielen thematisiert. Ziel ist ein emotionales Klavierspiel, das über technische Fertigkeiten hinausgeht und das Publikum berührt.