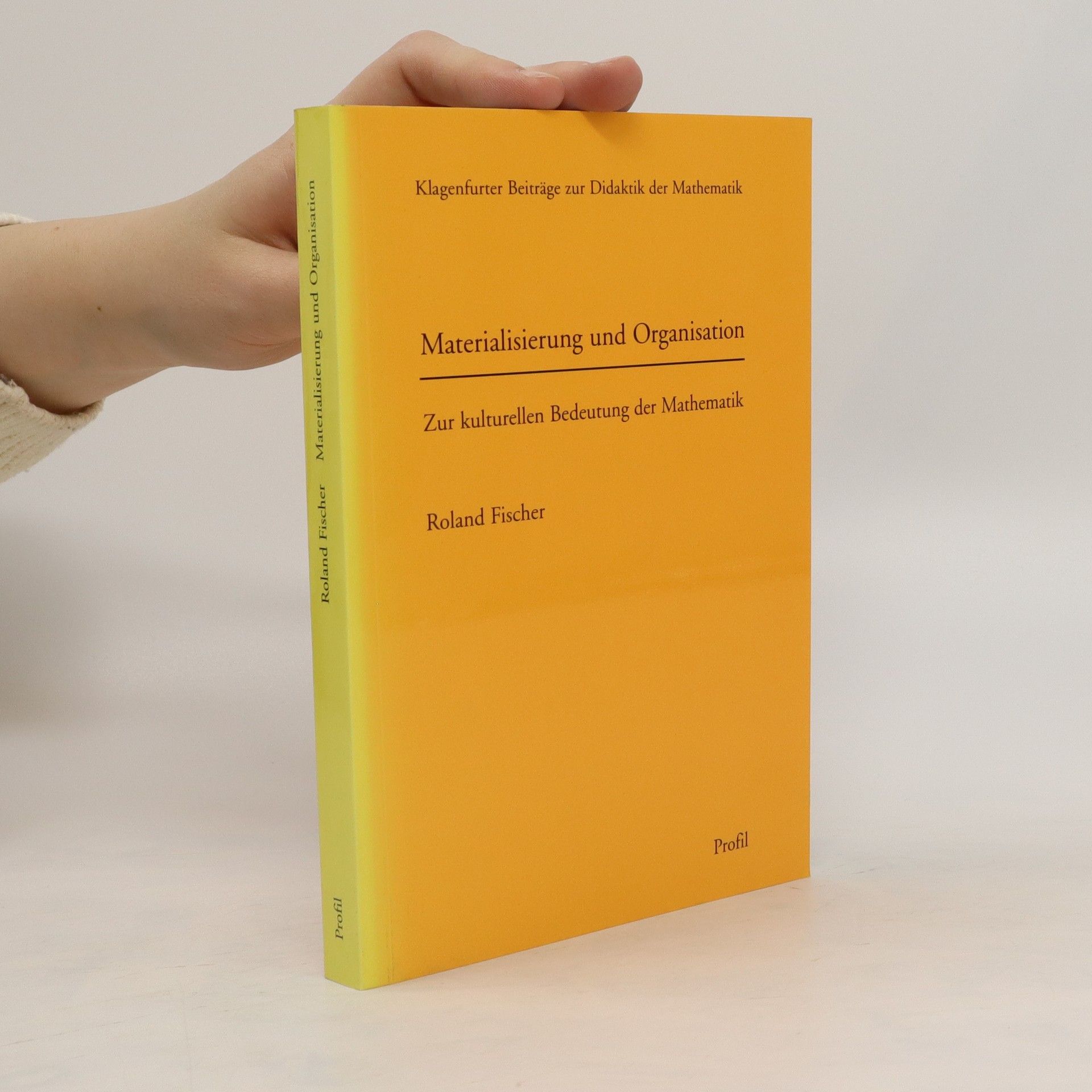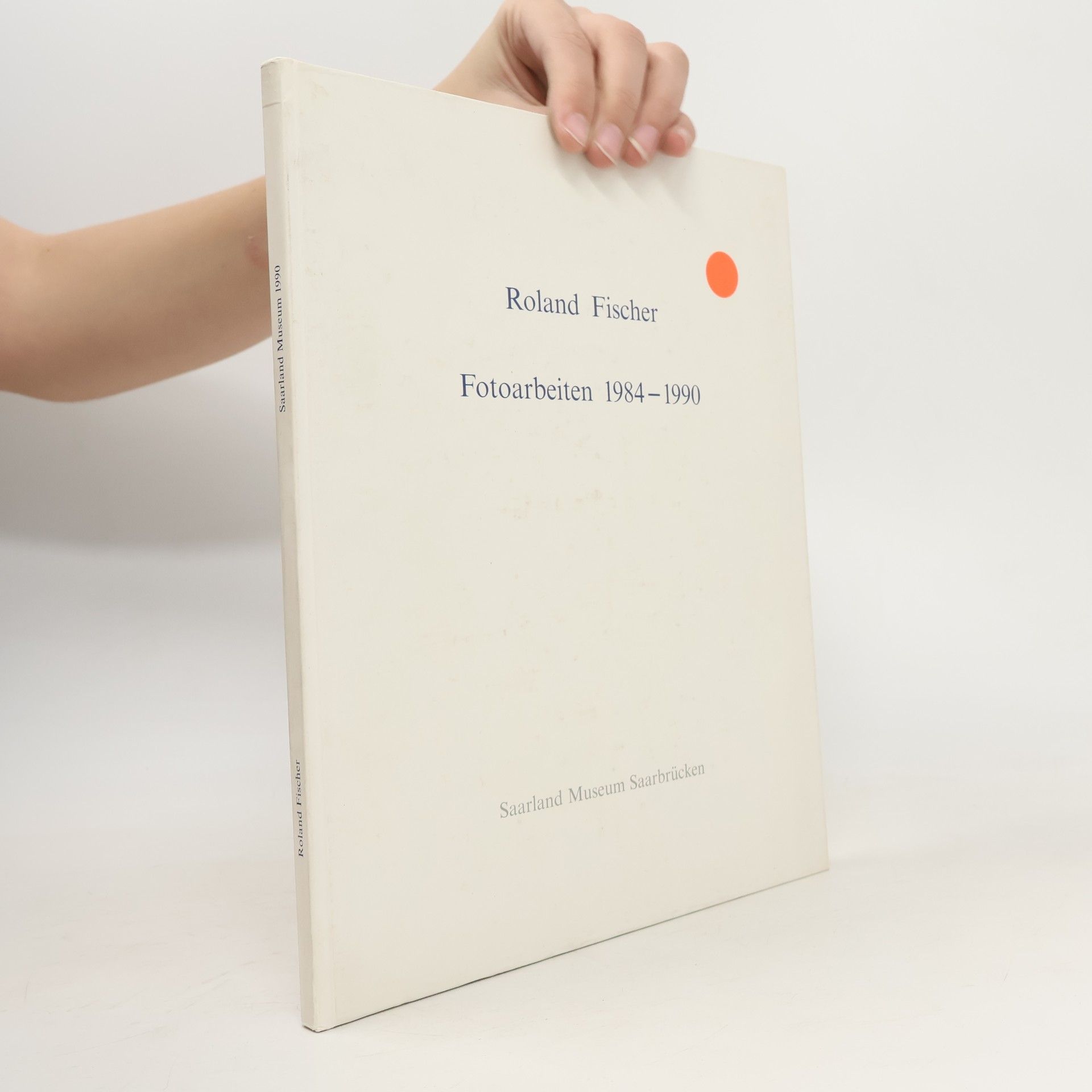ilm-Stills sind sowohl visuelle Spuren des Films als auch eigenständige fotografische Bildformen. Während Dreharbeiten auf Filmsets von eigens engagierten Standfotografen angefertigt, basieren sie auf einem komplizierten und aufwendigen Verfahren, bei dem Szenen des Films speziell für den Fotoapparat reinszeniert werden, womit der Film von einem bewegten zu einem statischen Medium transformiert wird. In einer umfassenden Ausstellung widmet sich die Albertina erstmals diesem hybriden Genre und zeigt 150 Film-Stills der 1910er bis 1970er Jahre. Werden Film-Stills herkömmlicherweise als bloße filmische Referenz (miss)verstanden, die eher den Blick des Kameramannes und des Regisseurs als den des Fotografen widerspiegeln, so werden sie hier als eigenständige fotografische Bildformen untersucht, die einer selbstständigen, durchaus vom Film losgelösten Betrachtung bedürfen. Verschiedene Aspekte der intermedialen Bezüge dieses Genres werden untersucht: Die von Brüchen und Kopplungen gekennzeichneten Schnittstellen zwischen Fotografie und Film, die Funktion von Standbildern sowie ihr Verhältnis zur bildenden Kunst werden beleuchtet. Fotografen: Raymond Cauchetier, Horst von Harbou, Chris Marker, Atelier Manassé, Hans Natge, Angelo Novi, Georges Pierre, Karl Struss et al.
Roland Fischer Bücher




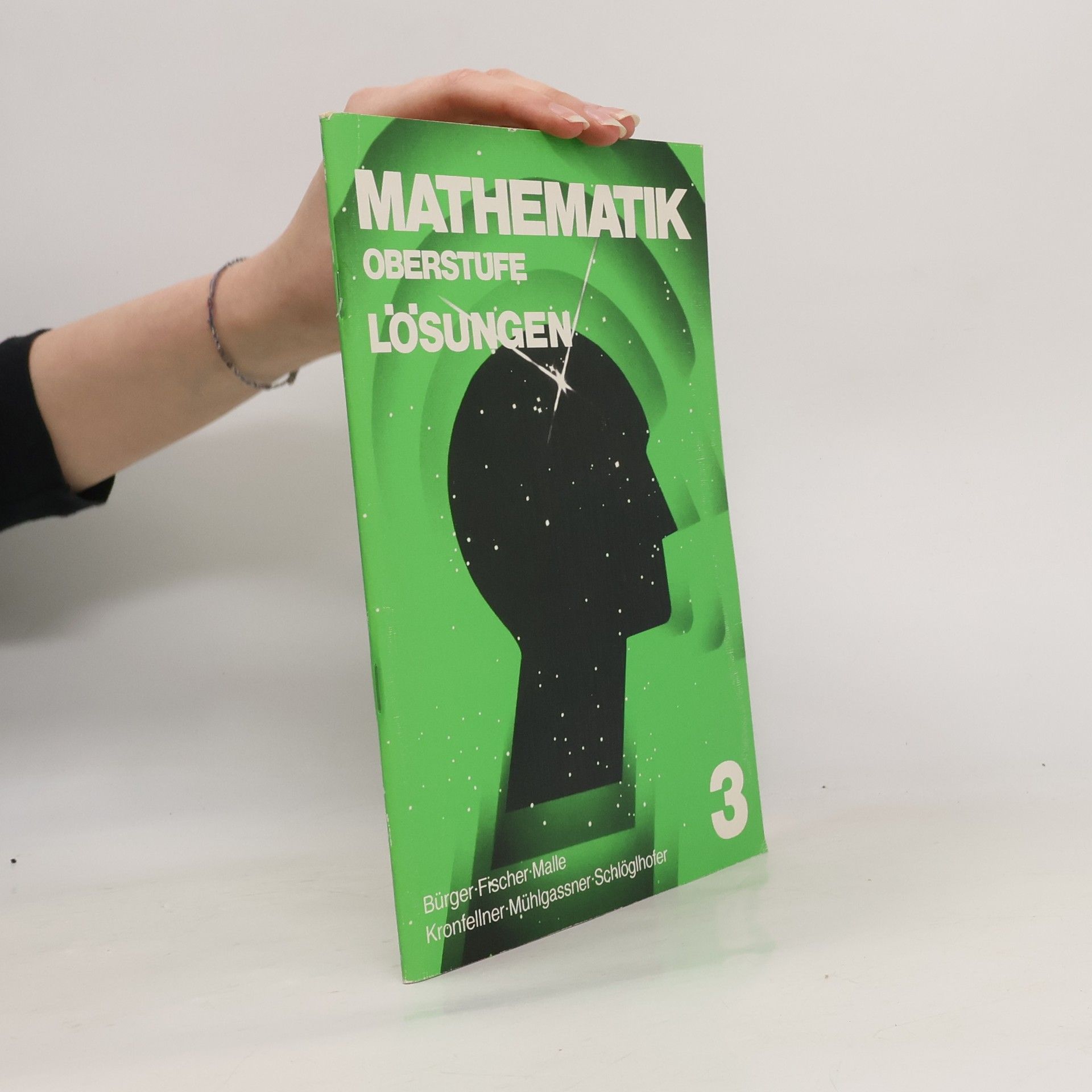
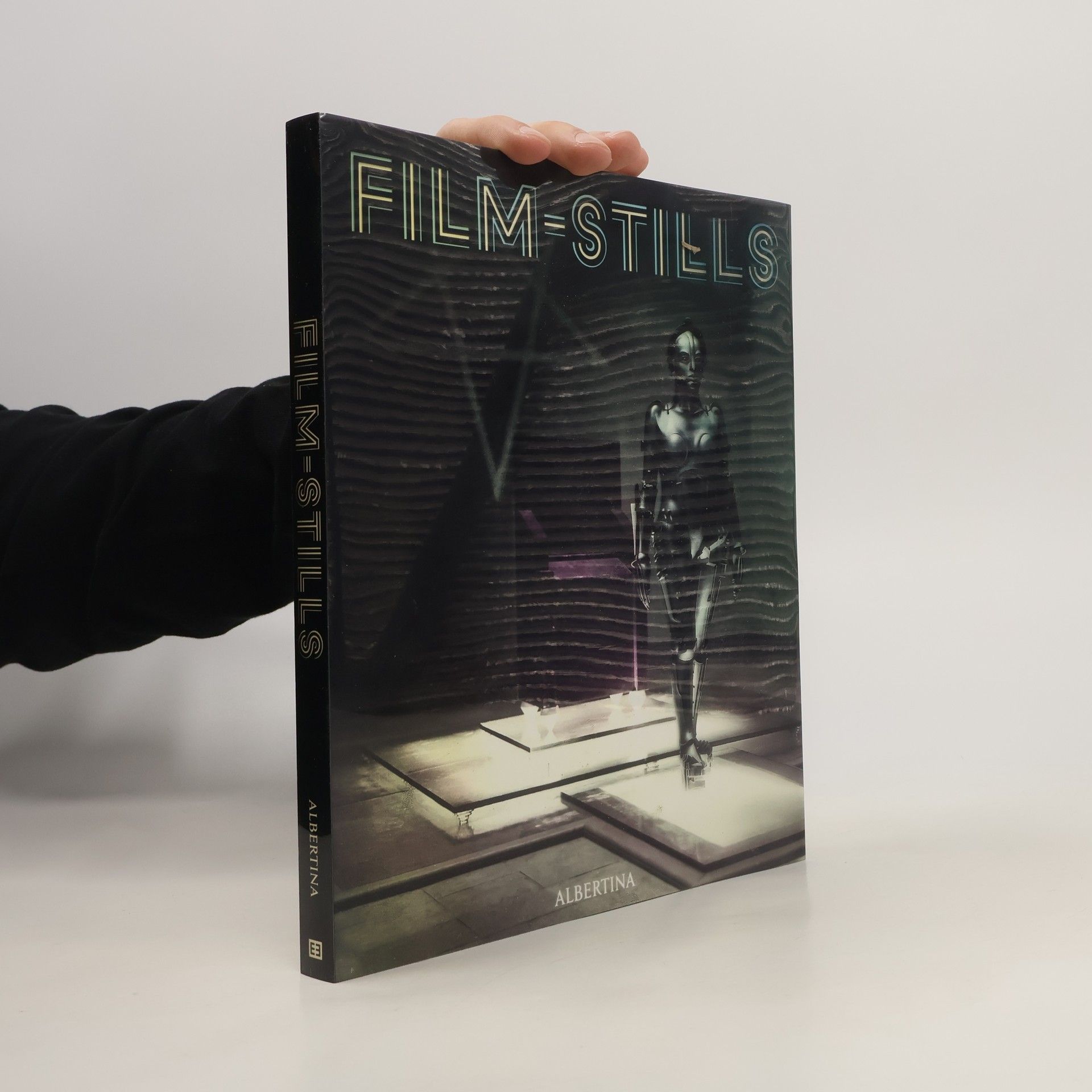
Mathematik Oberstufe
- 96 Seiten
- 4 Lesestunden
Wir suchen eine Insel
- 84 Seiten
- 3 Lesestunden
Im Wald herrscht reges Treiben, was die Tiere stört. Ein Reh, ein Feldhase und eine Haselmaus träumen von einem ruhigen Ort. Ein Waschbär erzählt von einer Insel, doch die Tiere brauchen Menschenhilfe, um ein Floß zu bauen. Zwei Kinder und ihr Großvater unterstützen sie, doch die Überfahrt birgt viele Abenteuer.
Domänen fächerorientierter Allgemeinbildung
- 304 Seiten
- 11 Lesestunden
Über welche Allgemeinbildung sollen Menschen am Ende der Pflichtschulzeit verfügen? Was ist dabei die Rolle der Schulfächer? Braucht es sie überhaupt, und, wenn ja, welche? Und was wird von ihnen vermittelt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich dieser Band. Es werden „Bildungs-Domänen“ vorgeschlagen, in denen herkömmliche Schulfächer sowie darüber hinausgehende Wissensgebiete in einen ganzheitlichen Kontext gestellt werden. Als wichtigstes Kriterium für Bildungsrelevanz wird dabei der Beitrag für individuelle und gesellschaftliche Entscheidungsfähigkeit gesehen. Schulentwicklung muss sich auch inhaltlichen Fragen stellen. Neben der Ergebnissicherung durch Bildungsstandards und teilstandardisierte Abschlussprüfungen sind Antworten auf die Frage nach dem Bildungsauftrag der Fächer zu finden. Diese Frage kann allein von den Positionen der Einzelfächer ausgehend nicht ausreichend beantwortet werden, es braucht den Dialog der Fächer und gesamthafte Perspektiven. Dabei geht es auch um die Etablierung einer Diskursebene im Unterricht selbst, die Relevanz und Reichweite, Form und gesellschaftliche Bedeutung des Fachwissens bewusst macht. Die im Band enthaltenen Texte sind das Ergebnis einer Kooperation von drei Institutionen: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien-Krems und Pädagogische Hochschule Oberösterreich. Seit 2008 arbeiten über 20 FachdidaktikerInnen an diesem Projekt.
Zukunft der Weiterbildung
- 520 Seiten
- 19 Lesestunden
Das Anthroponomikum
Oder warum es an der Zeit ist, unsere technischen Möglichkeiten sinnvoll anzuwenden
- 360 Seiten
- 13 Lesestunden
Gelingt die Transformation zur Nachhaltigkeit? Müssen die Probleme erst eskalieren, oder kann die Politik auch aus Einsicht in die Notwendigkeit entschlossen handeln? Roland Fischer stellt dar, wie die Menschheit neue Herausforderungen immer wieder erfolgreich bewältigt hat. Und er lenkt den Blick darauf, wie in den letzten Jahrzehnten das Unbehagen an den Errungenschaften der Moderne immer weiter zunimmt – weil sich in der modernen Welt das Wünschenswerte oft nicht von seinen schädlichen Nebenwirkungen trennen lässt.Dieses Buch beginnt als kenntnisreiche Spurensuche und entwickelt sich zu einem weitsichtigen und dabei oft humorvollen Plädoyer für ein neues Denken und Handeln. Es tritt für den tief greifenden Kulturwandel ein, den wir jetzt nicht den materiellen Wohlstand unendlich zu steigern, sondern seine Dauerhaftigkeit zu erreichen. Dafür brauchen wir manchmal den Mut zur Veränderung, manchmal den Mut, Bewährtes zu bewahren – und stets ein Urteilsvermögen dafür, welches von den beiden zukunftsweisend ist.
Schritte plus neu
- 100 Seiten
- 4 Lesestunden
Neue Fallstudien zur Wertermittlung von Immobilien
- 885 Seiten
- 31 Lesestunden
Hier gewinnen Sie als Praktiker oder angehender Sachverständiger den notwendigen Wissensvorsprung: mit den neuen Fallstudien zur ImmoWertV – für die Wertermittlung von Immobilien. Die 2. Auflage hält viel Neues für Sie bereit: So finden Sie darin Beispielgutachten für - die Bewertung von Grundstücken mit Anlagen zum Klimaschutz sowie zur alternativen Energieerzeugung von Windkraft- und Biogasanlagen, Fotovoltaik, Kurzumtrieb-Anlagen - Spezialfälle der Immobilienwertermittlung - Investmentgesellschaften - Infrastrukturmaßnahmen Alle Fallstudien stammen aus der langjährigen Bewertungspraxis der Autoren selbst. Damit lesen Sie ausschließlich tatsächliche Gutachten aus realen Bewertungsfällen! Das Spektrum reicht dabei von bebauten über unbebaute bis hin zu landwirtschaftlichen Grundstücken. Selbstverständlich regelgerecht bewertet nach den Anforderungen der neuen ImmoWertV.
Materialisierung und Organisation
Zur kulturellen Bedeutung der Mathematik
Warum ist die Mathematik aus einer modernen Gesellschaft nicht wegzudenken? Weil sie Abstraktes materialisiert und damit das Entscheiden unterstützt. Insbesondere unterstützt sie das Entscheiden großer sozialer Systeme. Mathematische Denk- und Darstellungsformen sind Grundlage für regelhafte Organisationen wie Bürokratie oder Markt. Ihre Grenzen sind damit auch Grenzen dieses Typs von Organisation. Mathematik hat aber auch das Potential der Überwindung dieser Grenzen, wodurch sie eine neue Bedeutung erlangen könnte. Inhalt: Vorwort - Einleitung - Mathematik anthropologisch: Materialiseirung und Systemhaftigkeit - Mathematik, ihre Rolle bei gesellschaftlichen Entscheidungen - Längerfristige Perspektiven des Mathematikunterrichts - Bedeutungs- und Nutzungswert der Mathematik - Mathematik und Organisation - Technologie, Mathematik und Bewusstsein der Gesellschaft - Anhang: Zum Verhältnis von Mathematik und Kommunikation - Offene Mathematik und Visualisierung - Mathematik und gesellschaftlicher Wandel - Beziehungspunkte zwischen Mathematik und Politik
Roland Fischer
- 76 Seiten
- 3 Lesestunden