Im Bann des Nationalsozialismus
Das protestantische Berlin im Dritten Reich


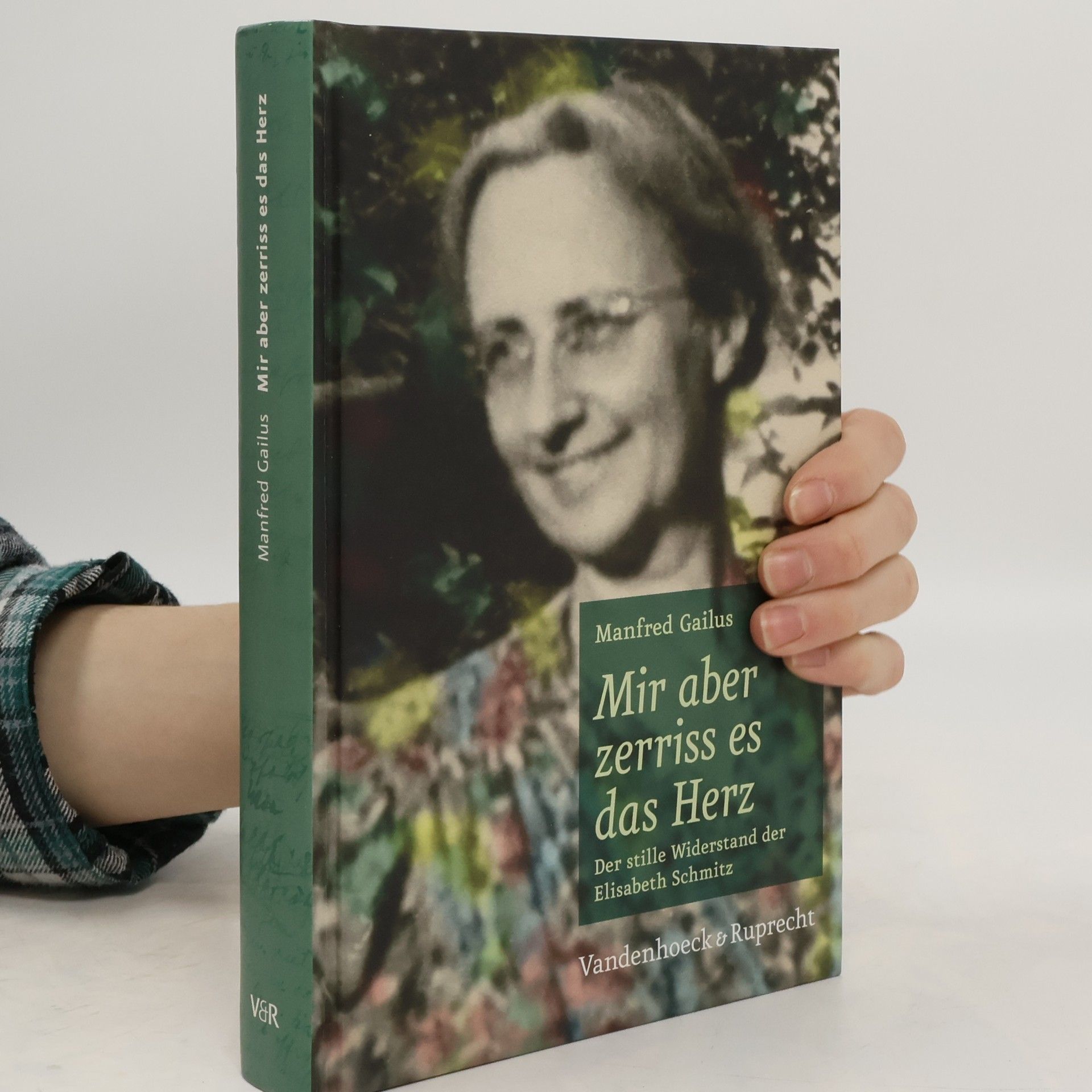



Das protestantische Berlin im Dritten Reich
"Woran glaubten die 65 Millionen Deutschen im Dritten Reich? Welche Rolle spielte die »religiöse Frage« für Bestand und Stabilität des NS-Regimes? Wie dieses Buch zeigt, war die Hitlerzeit nicht, wie bisher weithin angenommen, von Säkularisierungsprozessen oder sogar von »Gottlosigkeit« bestimmt, sondern vielmehr von multiplen religiösen Erneuerungen geprägt. Bereits das politische Umbruchsjahr 1933 war von einem tiefgehenden »religious revival« begleitet. Eine uns heute paradox anmutende Gemengelage von christlichen Traditionsbeständen und einem völkisch-politischen Neuglaube spielte eine wesentliche Rolle im Nationalsozialismus"-- Back cover.
Wie wurde ich eigentlich Nationalsozialist? Diese Frage stellte der junge SAMann Horst Wessel ins Zentrum seiner bislang unveröffentlichten politischen Autobiographie, die er wenige Monate vor seinem gewaltsamen Tod im Jahr 1930 schrieb. Es handelt sich um eine einzigartige Geschichtsquelle, die bezeichnende Schlaglichter auf die politische Kultur der Weimarer Republik und auf den frühen Nationalsozialismus wirft. Ein spannendes Zeitdokument, herausgegeben und kommentiert von zwei profilierten Zeithistorikern – für alle, die besser verstehen wollen, wie die nationalsozialistische Diktatur eigentlich möglich wurde. Erste vollständige und kritisch kommentierte Ausgabe eines bislang unbekannten Zeitdokuments »Gut recherchiert, glänzend geschrieben.« Die Welt am Sonntag über Daniel Siemens’ Horst-Wessel-Biographie
Mit der einsetzenden nationalsozialistischen Rassenpolitik fiel den Kirchen eine neue Bedeutung zu: sie verwalteten mit den Kirchenbüchern wesentliche bevölkerungsgeschichtliche Personendaten, die für die nationalsozialistische Unterscheidung zwischen »Ariern« und »Nichtariern« relevant waren. Staats- und Parteistellen verlangten »Amtshilfe«: die Auslieferung dieser Daten. Und die Kirchen kamen dieser Forderung – meist sehr bereitwillig – nach. In vielen Fällen leisteten kirchliche Mitarbeiter (Pfarrer, Kirchenbeamte u. a.) aktive Beiträge zur NS-Sippenforschung. Nicht selten entstanden besondere Kirchenbuchstellen, die rassistisch motivierte Forschung betrieben und die Resultate an staatliche Behörden und Parteistellen weiter reichten. In fünf Regionalstudien berichtet dieser Band über unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit von evangelischen Landeskirchen und Dienststellen von NS-Staat und NSDAP auf dem Gebiet der Urkundenausstellung für den »Ariernachweis«. Zugleich wird gezeigt, wie mit diesem brisanten Thema in der Nachkriegszeit verfahren wurde.
Zur Sozialgeschichte der Strasse, 1830-1980