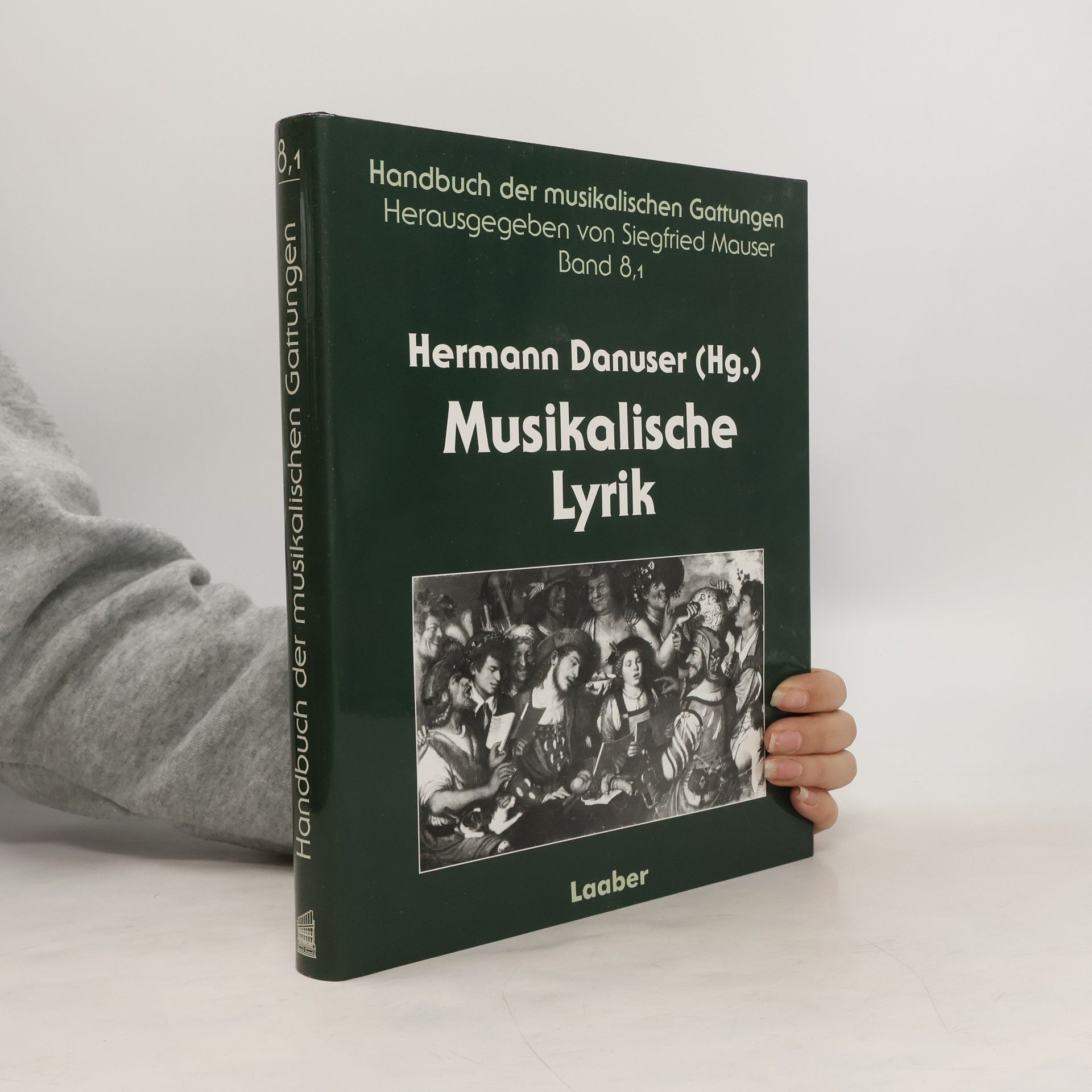Im Jahr 1785 setzt ein reger Briefwechsel zwischen den Dichtern Johann Georg Jacobi(1740 – 1814) und Gottlieb Konrad Pfeffel (1736 – 1809) ein, der erst mit Pfeffels Todabbricht. Der Austausch ist ein bedeutendes Dokument der Freundschaftskultur desspäten 18. Jahrhunderts. Zugleich ist er ein wichtiges Referenzwerk für die Literatur und Kulturgeschichte der Umbruchzeit um 1800: Neben politischen Stellungnahmen bietet die Korrespondenz sozialhistorische Einblicke in die Universitäts‑ und Kirchenpolitik der Epoche und in die kollaborative Poetik der beiden Dichter, die als Repräsentanten einer untergehenden Zeit gemeinsam an ihrem Andenken arbeiten. Die insgesamt 139 überlieferten Briefe werden hier erstmals vollständig nach den handschriftlichen Quellen ediert und ausführlich kommentiert.
Achim Aurnhammer Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)





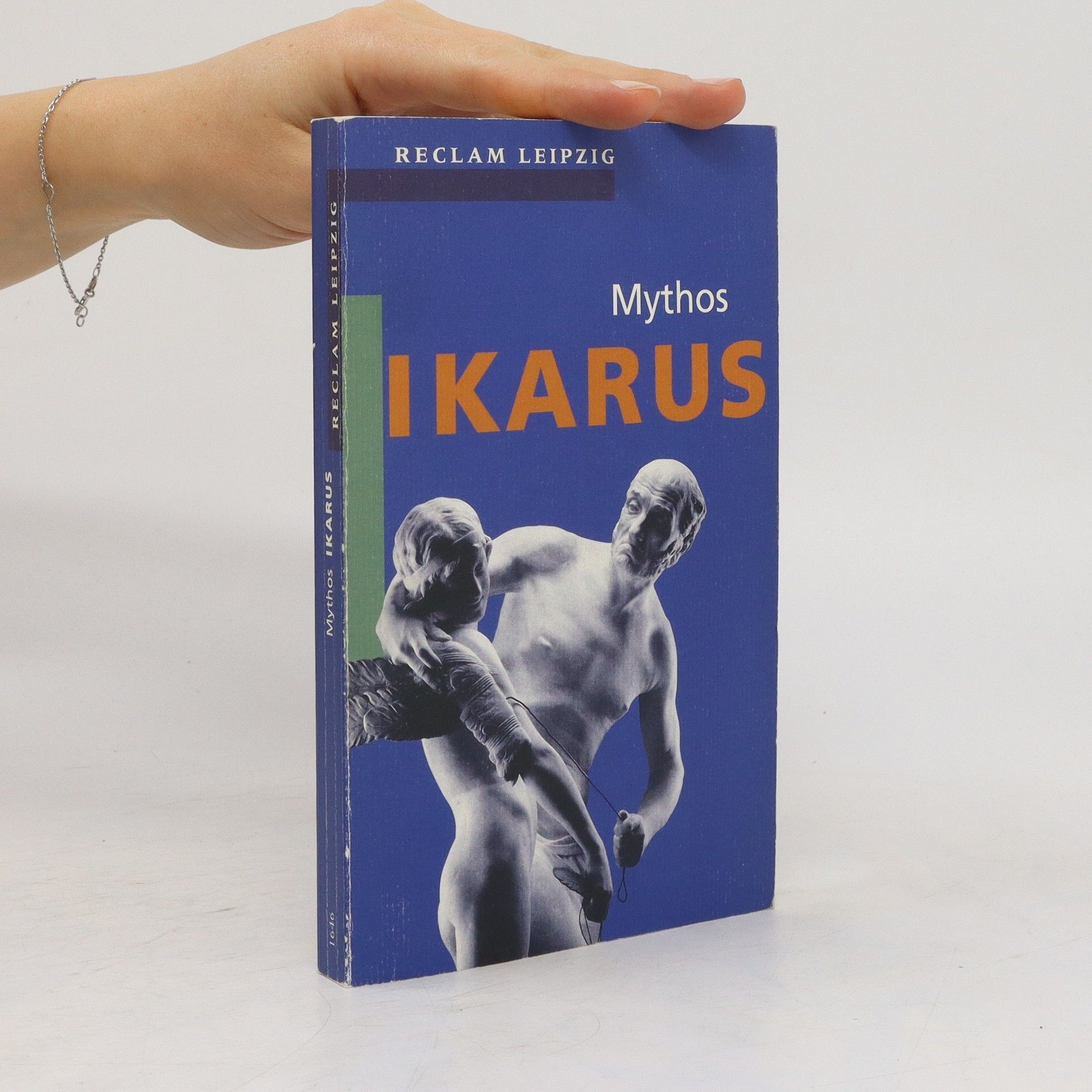
Die Vierhundert Pforzheimer
Entstehung, Popularisierung und Dekonstruktion einer Heldenlegende
2022 jährt sich zum vierhundertsten Mal die Geburt eines deutschlandweit in allen Medien gefeierten Heldenkollektivs: die vierhundert Pforzheimer Bürger. Der Opfertod der vierhundert Pforzheimer Bürger, die 1622 in der Schlacht bei Wimpfen im Dreißigjährigen Krieg den Rückzug ihres geschlagenen Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach deckten, war bis ins 20. Jahrhundert ein wichtiges Datum im kollektiven Gedächtnis der Deutschen. Das bürgerliche Heldenkollektiv wurde im 18. und 19. Jahrhundert deutschlandweit in Dramen, politischen Reden, Gedichten, Erzählungen und bildkünstlerischen Werken zum frühen Kronzeugen eines Verfassungspatriotismus stilisiert, bevor es in der Moderne als Fiktion entlarvt wurde. Abgesehen von einigen noch heute prominenten Autoren wie Ernst Ludwig Posselt und Georg Büchner sind die meisten literarischen und bildkünstlerischen Zeugnisse inzwischen weitgehend vergessen. Dennoch ermöglicht die Rekonstruktion, dichte Beschreibung und Deutung des Heldenkollektivs unabhängig von seinem historischen Wahrheitsgehalt genaue Einblicke in Genese, Funktion und Dekonstruktion einer Heldenlegende, die weit über die regionalen Aspekte hinausgeht. Somit liefert die Fallstudie einen wichtigen Beitrag zur Heldenforschung.
Soll man es wagen?
Briefwechsel zwischen Rainer Maria Rilke und Agnes Therese Brumof (1918–1926)
- 227 Seiten
- 8 Lesestunden
Soll man es wagen?' 0? richtet sich Agnes Therese Brumof an Rilke, den Adressaten ihres Briefes. 'Wir wohnen zwar in verschiedenen Hotels, aber?'0Ein neu entdeckter Briefwechsel zwischen Rainer Maria Rilke und der Kostümbildnerin, Buchillustratorin und bislang unbekannten Lyrikerin wird hier erstmals zugänglich. Die kommentierte Edition wirft neues Licht auf Rilkes späte Münchner Jahre und seine Schweizer Zeit. Sie ist auch ein Zeugnis dafür, wie Rilke aus brieflicher Distanz charmant mit einer jüngeren Dame umgeht, die ein zartes Rendezvous nicht vergessen mag. 0Der Band gibt darüber hinaus Einblicke in das Leben einer emanzipierten Frau aus einer jüdischen Gelehrtenfamilie, die ihren Platz in der Gesellschaft der Weimarer Republik sucht und deren Gedichte hier erstmals publiziert werden. Agnes Thereses Schwester, Hilde Brumof (1902 1969), war seinerzeit eine gefeierte Primaballerina und Ballettmeisterin. Und so verwundert es nicht, dass die Korrespondenz zwischen Rilke und Agnes Therese Brumof auch wichtige Aufschlüsse über die zeitgenössische Tanzbewegung und den Kulturbetrieb der Zwanziger Jahre liefert.
Die Schroedel Interpretationen bieten anspruchsvolle, doch verständlich und interessant geschriebene Darstellungen und Deutungen von wichtigen Werken der deutschen Literatur. Die Bände der Reihe eignen sich besonders zur Vorbereitung auf Referate, Hausarbeiten, Klausuren und Prüfungen. Mit tiefer Einsicht in die geheimen, schwer mitzuteilenden oder überhaupt verdrängten sexuellen Wünsche der beiden Hauptfiguren schildert Arthur Schnitzler in seiner "Traumnovelle" (1925/26) die inneren Spannungen in der Ehe eines Wiener Arztes und seiner Frau, die in den knapp eineinhalb Tagen der Handlungszeit kulminieren, als beide Partner auf Abwege geraten. Albertines Betrug an Fridolin findet dabei im Traum statt, von dem sie ihrem Mann erzählt. Ob Fridolin seine Abenteuer ebenfalls geträumt oder ob er sie wirklich erlebt hat, bleibt am Ende ebenso offen wie das weitere Schicksal der Ehe. Im vorliegenden Band wird unter anderem gezeigt, wie Schnitzler das Traumartige der Handlung durch die Wahl der Perspektive, die Verkettung von Motiven sowie weitere erzählerische Mittel betont.
Salvator Rosa in Deutschland
- 403 Seiten
- 15 Lesestunden
Der neapolitanische Maler und Dichter Salvator Rosa (1615–1673) ist eine der bedeutendsten Künstlergestalten des italienischen Hochbarocks. Er brillierte nicht nur als Maler, sondern auch als Virtuose in allen Künsten, als Kupferstecher, Dichter, Schauspieler und Musiker. Wirkungsvoll stilisierte er sich zum autonomen Genie und machte aus seiner gesellschaftskritischen Haltung keinen Hehl. Dem glatten bildkünstlerischen Akademismus setzte Rosa die Erhabenheit und Dramatik seiner Landschaften entgegen, kultivierte eine Vorliebe für ungelöste Spannungen wie Kontraste und scheute vor dem Hässlichen und Grotesken ebenso wenig zurück wie vor dem Magischen, Irrationalen und Unheimlichen. Diese zukunftsweisenden Aspekte von Rosas Leben und Werk fanden in Europa breite Resonanz. Salvator Rosas Wirkung auf die Künste in Deutschland wird in diesem Band erstmals systematisch erfasst, historisch kontextualisiert und interpretatorisch erschlossen.
Handbuch der musikalischen Gattungen - 8,1: Musikalische Lyrik
- 448 Seiten
- 16 Lesestunden
»Musikalische Lyrik« zielt nicht einfach auf eine aktualisierte Geschichte des Liedes. Der Begriff ist vielmehr programmatisch als ein Gegenkonzept zur hergebrachten Liedhistoriographie zu verstehen, deren ästhetische, politische und terminologische Limitationen vermieden werden sollen. Er meint ganz allgemein jede dichterische Lyrik, die in musikalischer Gestaltung erscheint, bzw. umgekehrt jede Musik, die von Aspekten der lyrik bestimmt ist. Der in zwei Teile gegliederte Band bietet in acht Kapiteln fortschreitende, auf Europa zentrierte Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart, die in einem letzten Kapitel Darstellungen zu den USA, Japan und Ghana ergänzen. Die musikhistorischen Hauptbeiträge werden durch parallele Essays aus der Feder namhafter Literaturwissenschaftler kontrapunktiert, welche die Gattungshistoriographie musikalischer Lyrik durch einen Wechsel der Perspektive vertiefen.
Mythos Ikarus
- 269 Seiten
- 10 Lesestunden