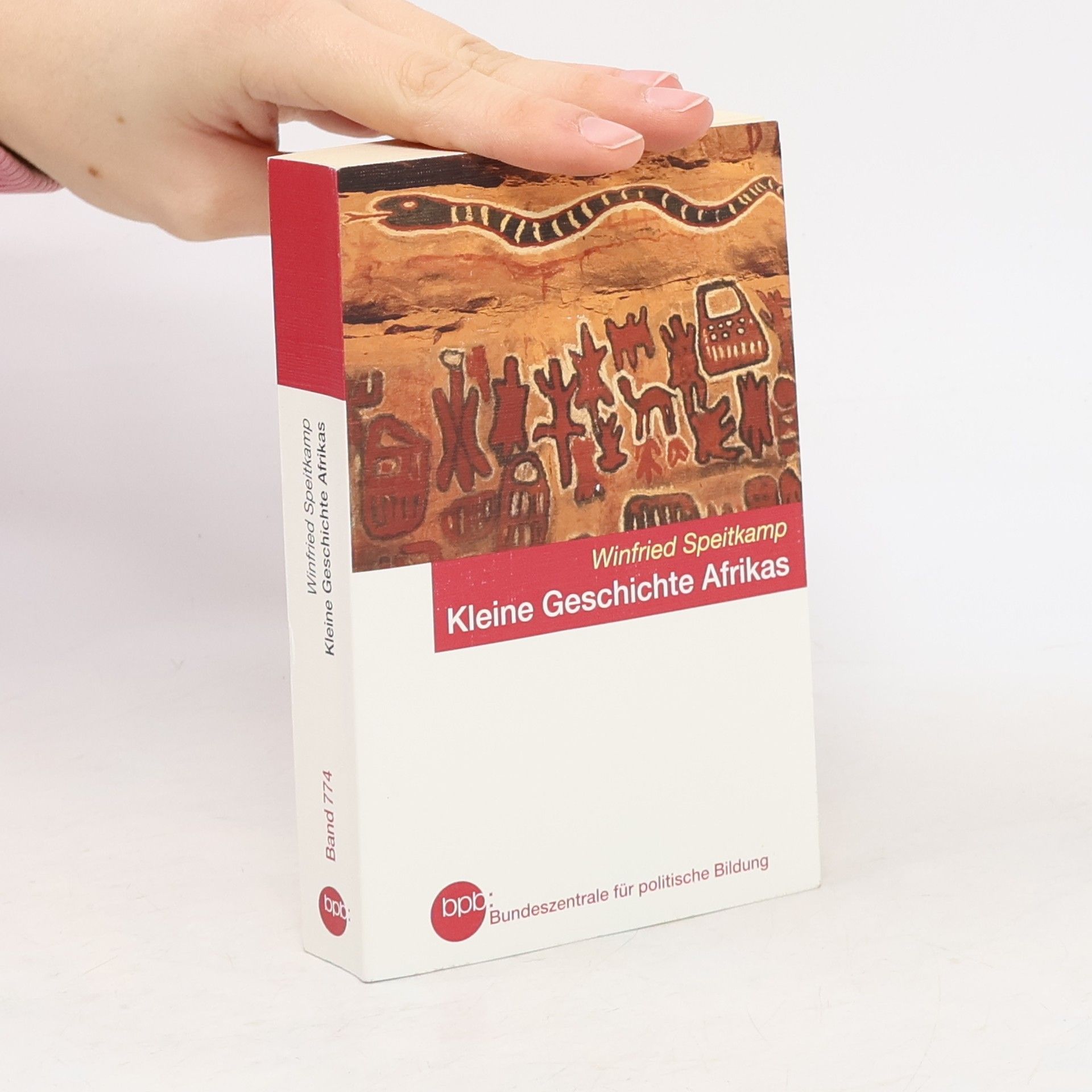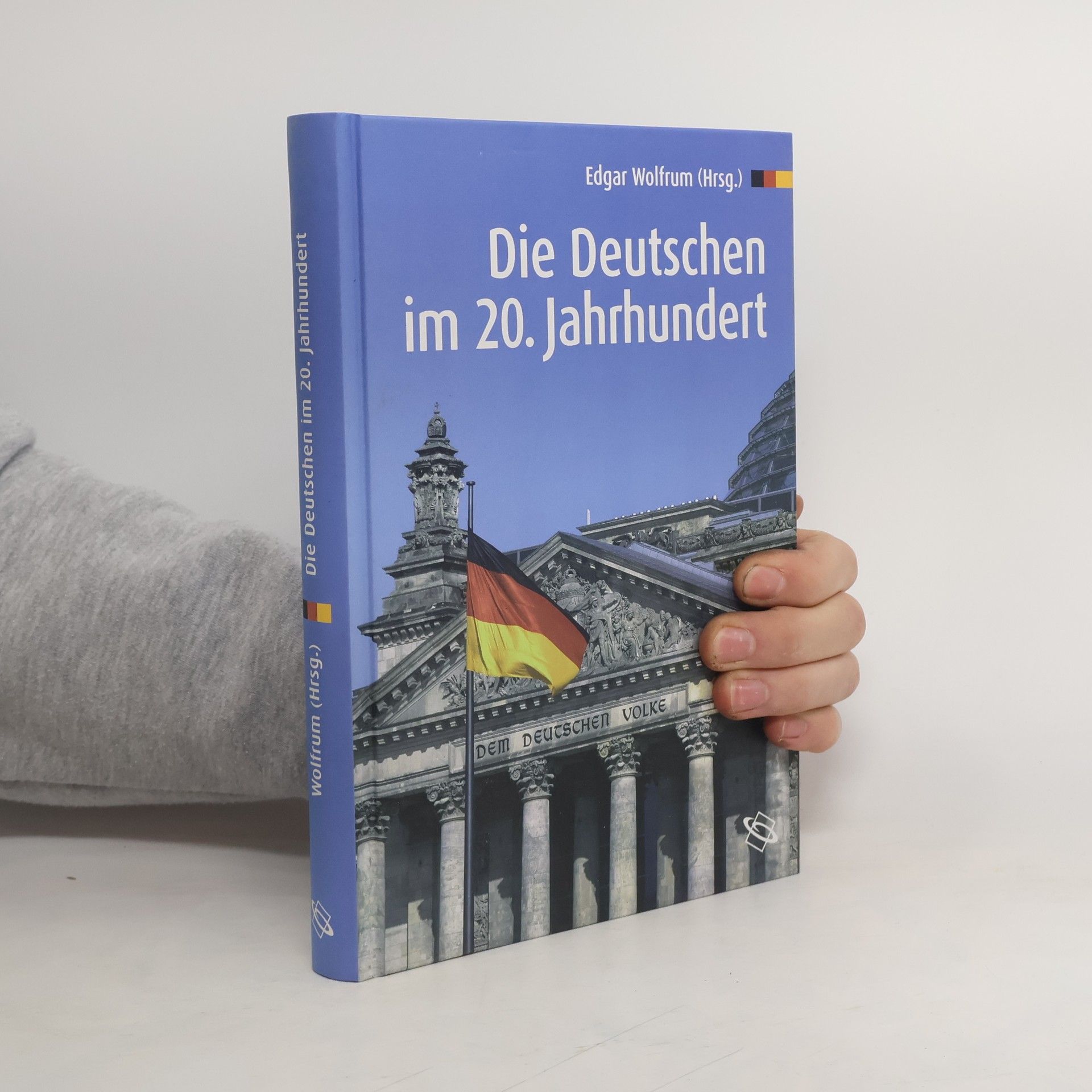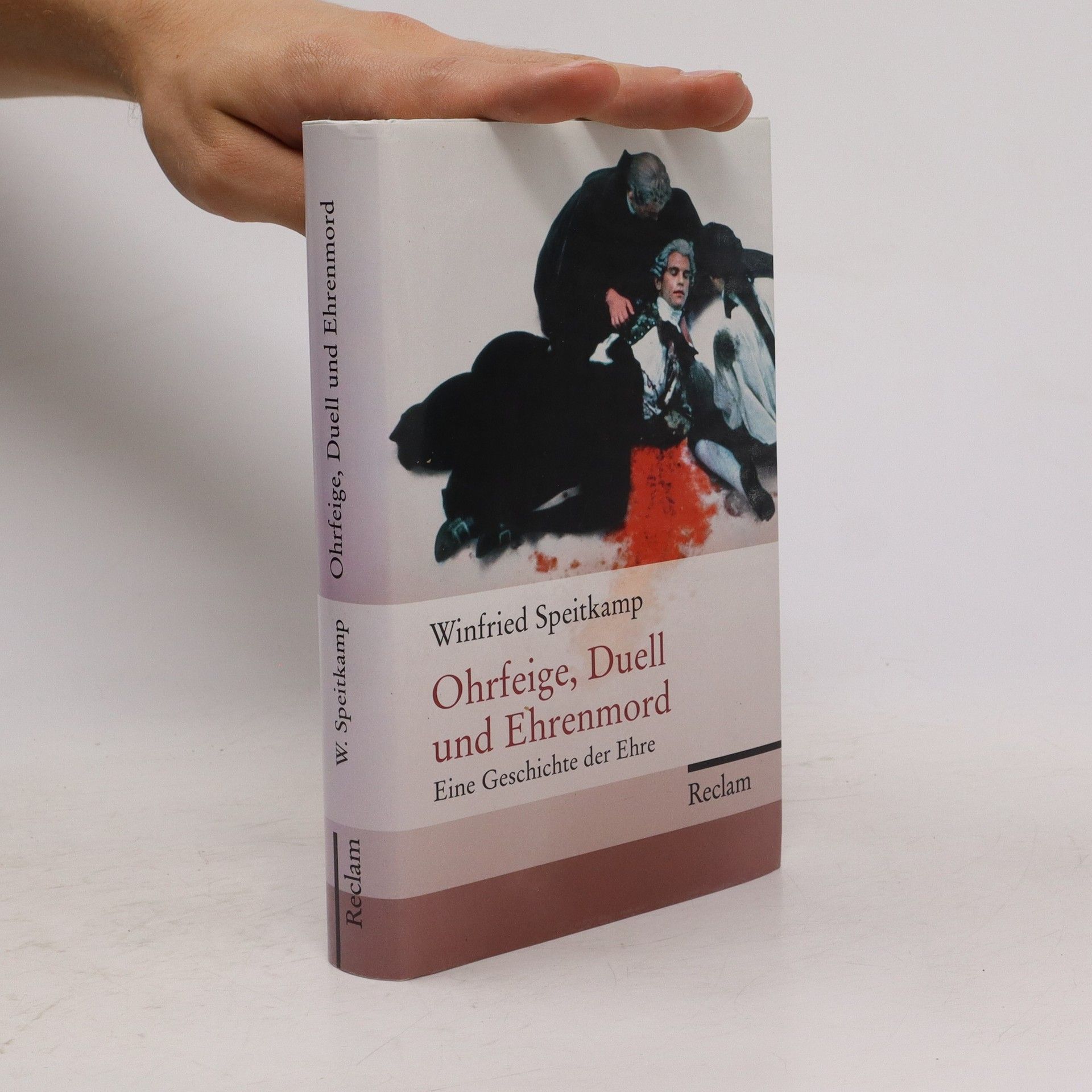Geschichte Afrikas
Speitkamp, Winfried – Erläuterungen, Analysen und Basiswissen – 14256 – Aktual. und erw. Ausgabe 2023
Lange hielt der Westen Afrika für einen »geschichtslosen Kontinent«. Dabei war das spätantike Reich von Axum im heutigen Äthiopien das erste christliche Königreich, und in mittelalterlichen Zentren wie Timbuktu blühten die Wissenschaft, der Handel und die islamische Religion. Winfried Speitkamp beschreibt die Vielfalt der Kulturen und Gesellschaftsformen insbesondere südlich der Sahara, die durch den europäischen Kolonialismus ab dem 19. Jahrhundert unterdrückt wurde. Dabei geht er auch auf die Umbrüche ein, die der afrikanische Kontinent seit der Befreiung von der Fremdherrschaft immer wieder erlebt.