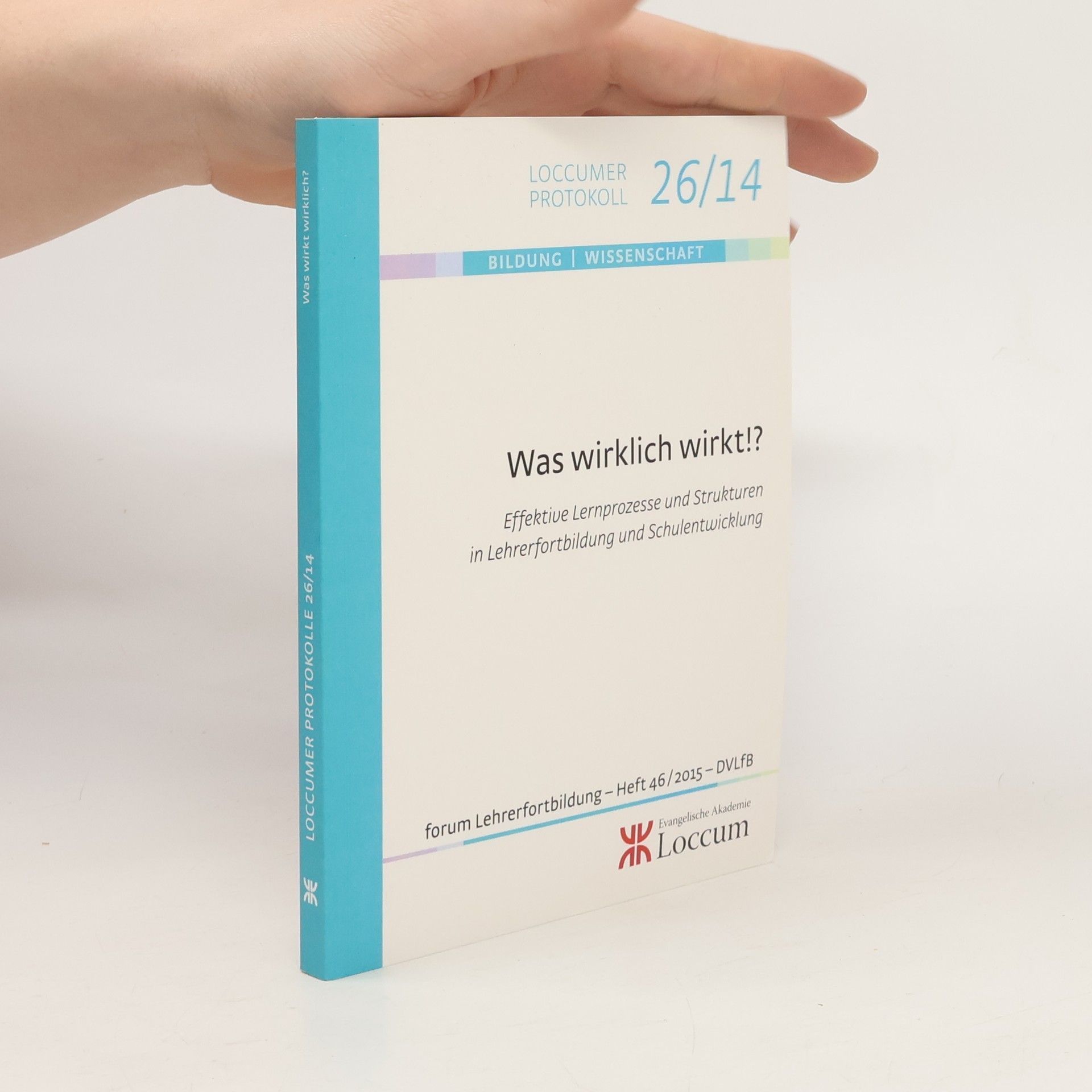Green Marketing 4.0
Ein Marketing-Guide für Green Davids und Greening Goliaths
- 200 Seiten
- 7 Lesestunden
Dieser Marketing-Guide richtet sich an Entscheidungsträger nachhaltiger Unternehmen und grüner Marken sowie Anbieter im Massenmarkt und beleuchtet den Wandel des grünen Marketings im Kontext von 4.0. Die Autorinnen adaptieren Philip Kotlers Marketing 4.0-Ansatz für das Nachhaltigkeitsmarketing und zeigen, wie Green Marketer die Transformation grüner Märkte aktiv gestalten können. Wichtige Fragen werden behandelt, wie die Positionierung von Green Davids als Vertrauens- und Qualitätsführer, der Beitrag von Greening Goliaths zur Markttransformation, die Relevanz der Wir-Ökonomie und die Lösung von Spannungsfeldern wie "Greenwashing". Das Buch bietet Modelle, Hintergründe und zahlreiche Beispiele sowie ein umfassendes Set an Essentials für die Umsetzung. Es gliedert sich in mehrere Teile: Der erste Teil navigiert durch den Wandel des Green Marketings, einschließlich der Entwicklung von Konsumenten und Produkten. Der zweite Teil behandelt die Transformation grüner Märkte und relevante Trends. Der stabile Kern des Green Marketings wird im dritten Teil thematisiert, gefolgt von einem Transformationsmodell in der Economy 4.0. Im letzten Teil werden neue Essentials des Green Marketing 4.0 vorgestellt, darunter narrativ geleitete Konzepte, die Gestaltung von Community-Erlebnissen und die Nutzung smarter Geschäftsmodelle.