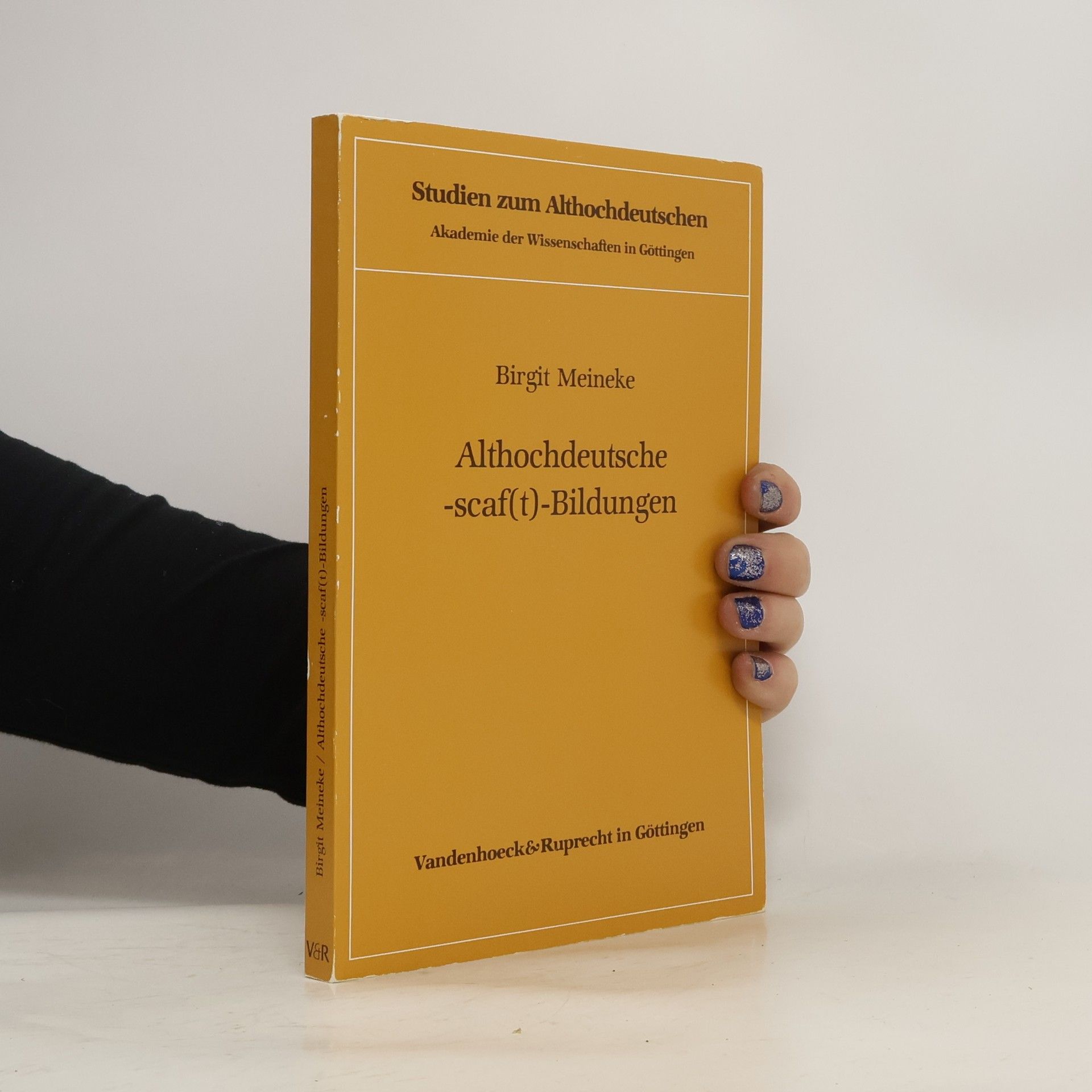Die Ortsnamen des Kreises Recklinghausen, der Stadt Bottrop und der Stadt Gelsenkirchen
- 480 Seiten
- 17 Lesestunden
Das Ortsnamenbuch für den Kreis Recklinghausen, die Stadt Gelsenkirchen und die Stadt Bottrop dokumentiert etwa 340 Siedlungsnamen, die seit der Karolingerzeit bis in die Jahre um 1600 erstmals schriftlich überliefert werden, darunter auch Namen von mehr als 160 (temporär oder dauerhaft) wüstgefallenen oder später überbauten Ansiedlungen. Einige der Siedlungsnamen beruhen auf sehr alten Gewässer- und Flurnamen und reichen damit weit in vorschriftliche Zeiten zurück. Der achtzehnte Band des Westfälischen Ortsnamenbuches erschließt sprachhistorisch ein Gebiet der westfälischen Siedlungsnamenlandschaft, die in ihren vielschichtigen Facetten in weiteren europäischen Zusammenhängen zu sehen ist. Als eine bedeutende Geschichtsquelle liefern die Siedlungsnamen zahlreiche Informationen für geographische, archäologische, landes- und ortsgeschichtliche, kulturhistorische, wirtschafts- und rechtsgeschichtliche Forschungen.0