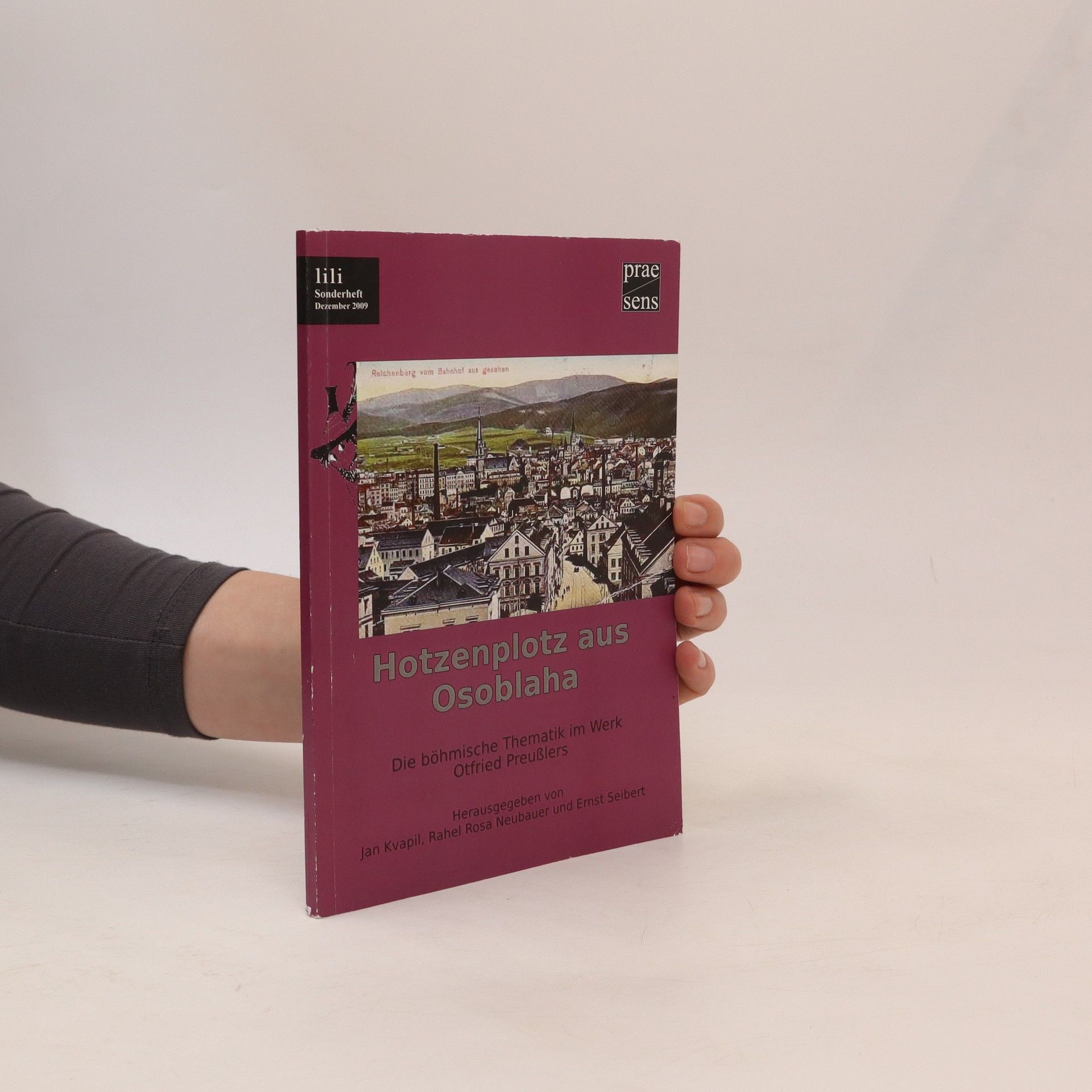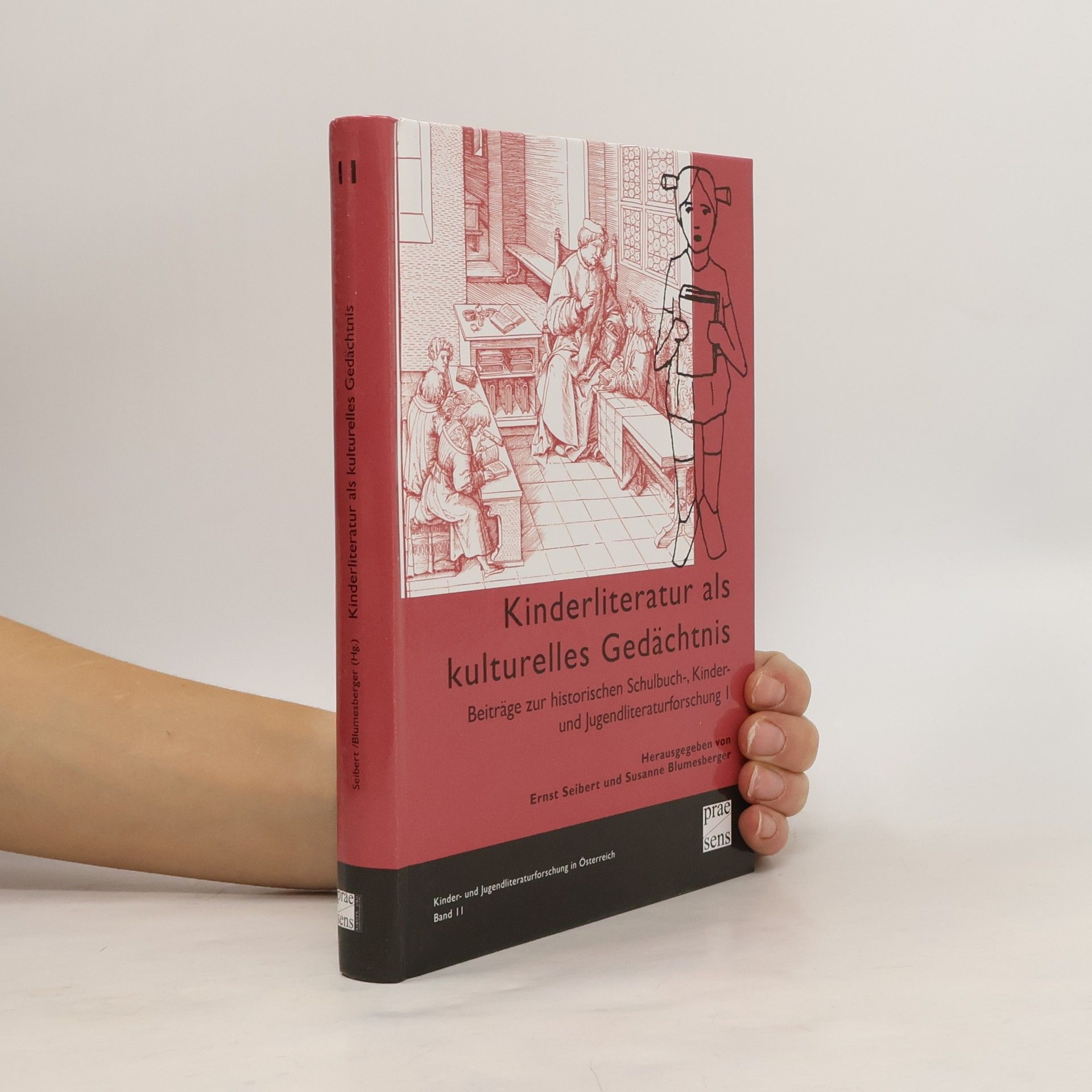Themen, Stoffe und Motive in der Literatur für Kinder und Jugendliche
- 206 Seiten
- 8 Lesestunden
Print on Demand Ausgabe (Lieferzeit ca. 5-6 Tage) Dieser Band erschließt die deutschsprachige Literatur für Kinder und Jugendliche von ihren Anfängen bis in die Gegenwart. Die Werke interessieren weniger als Erziehungsinstrument als in ihrer literarischen Qualität und in ihrem Wechselspiel zwischen Literatur für Kinder und allgemeiner Literatur. In vier großen Abschnitten, Formenwandel, Interdisziplinarität, Epochen und Gegenwart, werden die wichtigsten Positionen der Theoriediskussion zusammengefasst und anhand von Beispielen und Illustrationen von Wilhelm Busch über Franz Karl Ginzkey bis Otfried Preußler und von Vera Ferra-Mikura über Mira Lobe bis Käthe Recheis erläutert. Ergänzt durch ein Werkverzeichnis der Klassiker der Kinderliteratur und ein Sach- und Personenregister ist der Band ein praktisches Studienbuch für alle am Kinderbuch interessierten Berufssparten.