Der Karl-Christ-Preis, der dem Andenken an den Marburger Althistoriker Karl Christ gewidmet (1923?2008) ist, wurde im Jahr 2019 an den Ordinarius für Alte Geschichte der TU Dresden Martin Jehne verliehen. Jehne genießt als vorzüglicher Kenner der Geschichte der römischen Republik national wie international höchstes Ansehen. Seine wissenschaftsgeschichtlich und theoretisch reflektierten Beiträge zur politischen Kultur im Altertum sind weit über die Grenzen seines Faches rezipiert worden. In seinem herausragenden Einsatz für den akademischen Nachwuchs weiß er sich dem Erbe Karl Christs verpflichtet
Martin Jehne Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)


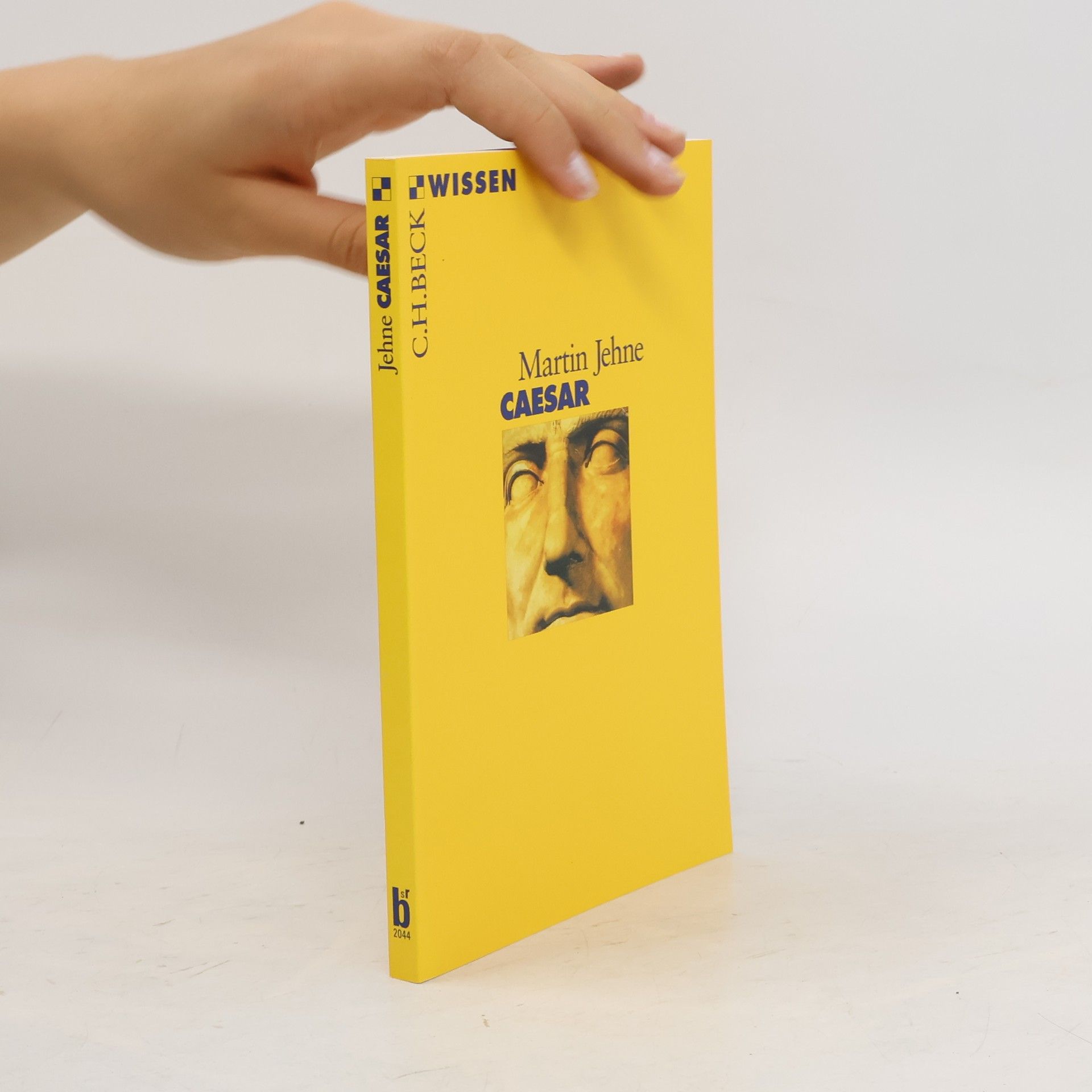
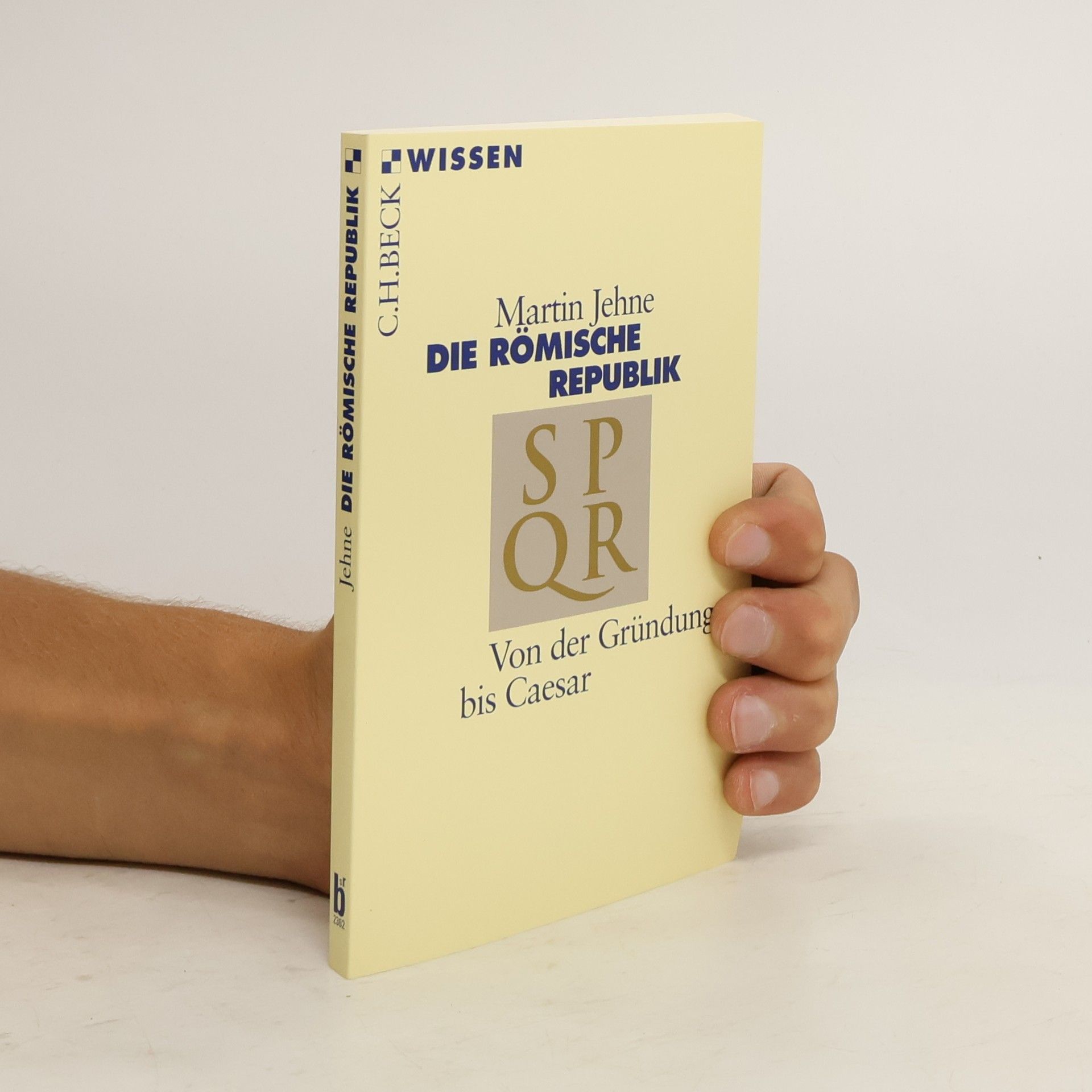
Der große Trend, der kleine Sachzwang und das handelnde Individuum
- 158 Seiten
- 6 Lesestunden
Caesars Entschluss, den Rubicon zu überschreiten und mit Soldaten in das Stadtgebiet einzumarschieren, weil der römische Senat ihm keine Zugeständnisse machen wollte, ist sprichwörtlich. Die Macht der großen Imperatoren war mit dem Gebot der Gleichheit in der römischen Führungsriege nicht mehr vereinbar. Die Entscheidung sorgte für das Ende der Republik. Caesars Gegenspieler Pompeius hätte sie vermutlich nicht getroffen. Caesar wich mehrfach von etablierten Verhaltenstraditionen ab und verweigerte sich dem Sachzwang. Es gab damals einen Veränderungstrend hin zur Monarchie, die Diagnose des Verfalls der Republik und das Gefühl der Ohnmacht. Auch wenn die Umstände sich verändert haben, ist uns dieses Gefühl heute wieder sehr vertraut. In diesen Zusammenhang ordnet Martin Jehne seine Betrachtungen ein. Mit Literaturhinweisen, Zeittafel und Personenregister.
Der Aufstieg Roms, die Ausformung und die Krisen des republikanischen Systems sowie die römische Ereignisgeschichte vom 5. Jh. v. Chr. bis zur Machtübernahme des Augustus sind Gegenstand dieses Bandes. Martin Jehne macht deutlich, daß die Herrschaft des Senats gegen Ende der Republik den Herausforderungen einer Weltreichsregierung nicht mehr gewachsen war. So zeichnet sich bereits in den letzten Jahrzehnten der Republik die neue Staatsform der Monarchie ab.
Caesar
- 126 Seiten
- 5 Lesestunden
Caesars Weg, auf dem er seinen Aufstieg betrieb, war nicht unbedingt neu; er folgte lange Zeit einem Kurs, der zwar den Standesgenossen mißfiel, aber keine unüberbrückbaren Gegensätze aufriß. Was jedoch bei Caesar neu war, war die Höhe seines Einsatzes. Schulden machte jeder für die Karriere, aber Caesar machte so hemmungslos Schulden, daß er am Rand der Katastrophe balancierte und jeder Rückschlag zur Katastrophe hätte werden können. Caesar erlitt aber keine Rückschläge, und davon war er offenkundig ausgegangen. Er glaubte so unerschütterlich an sein Glück und seine überlegenen Talente, daß auch der höchste Einsatz für ihn nur konsequent war. Er spielte ‚Alles oder Nichts‘, und er scheint nie daran gezweifelt zu haben, daß er gewinnen würde. Der vorliegende Band enthält eine fesselnde Biographie des wohl berühmtesten römischen Politikers, Militärs und – Spielers.