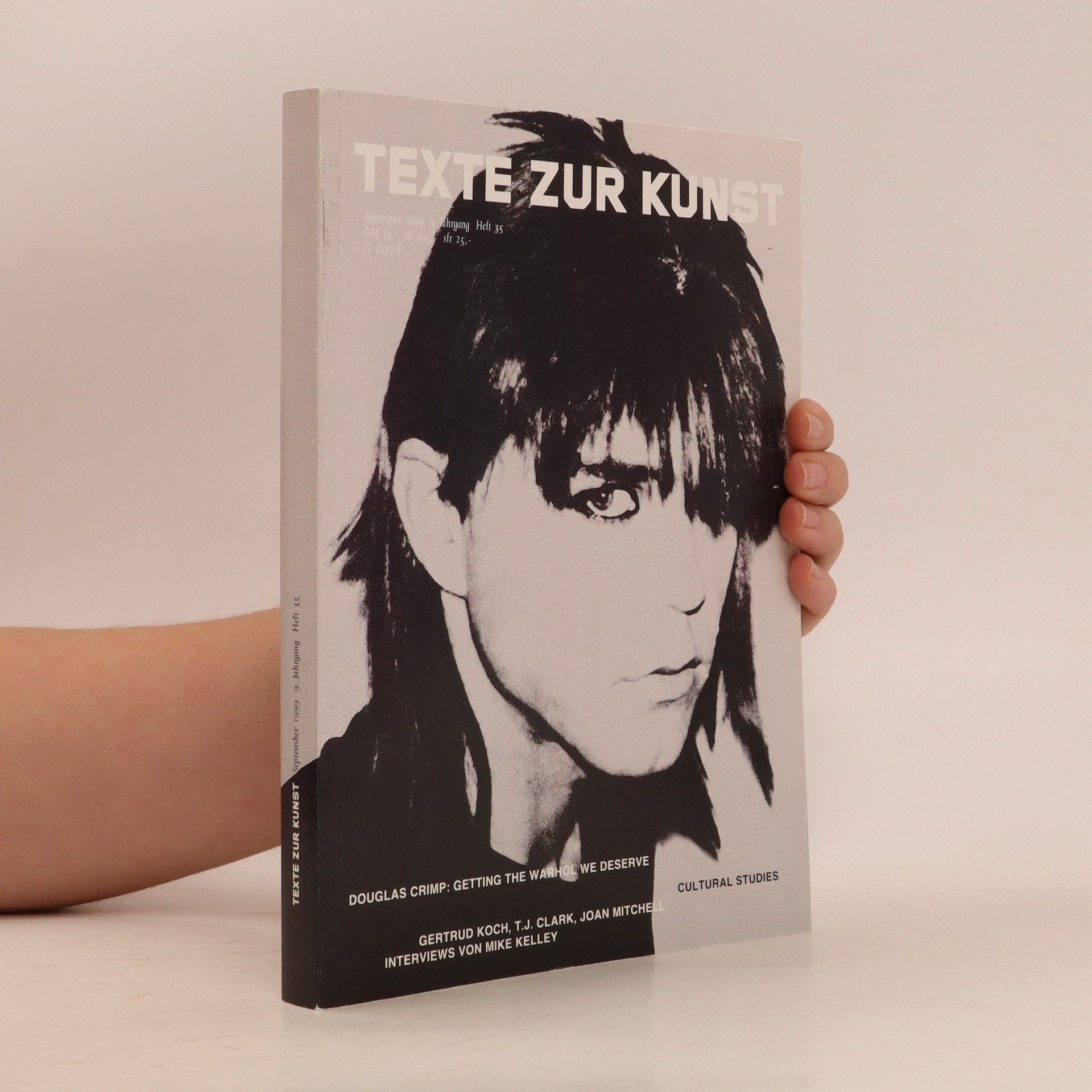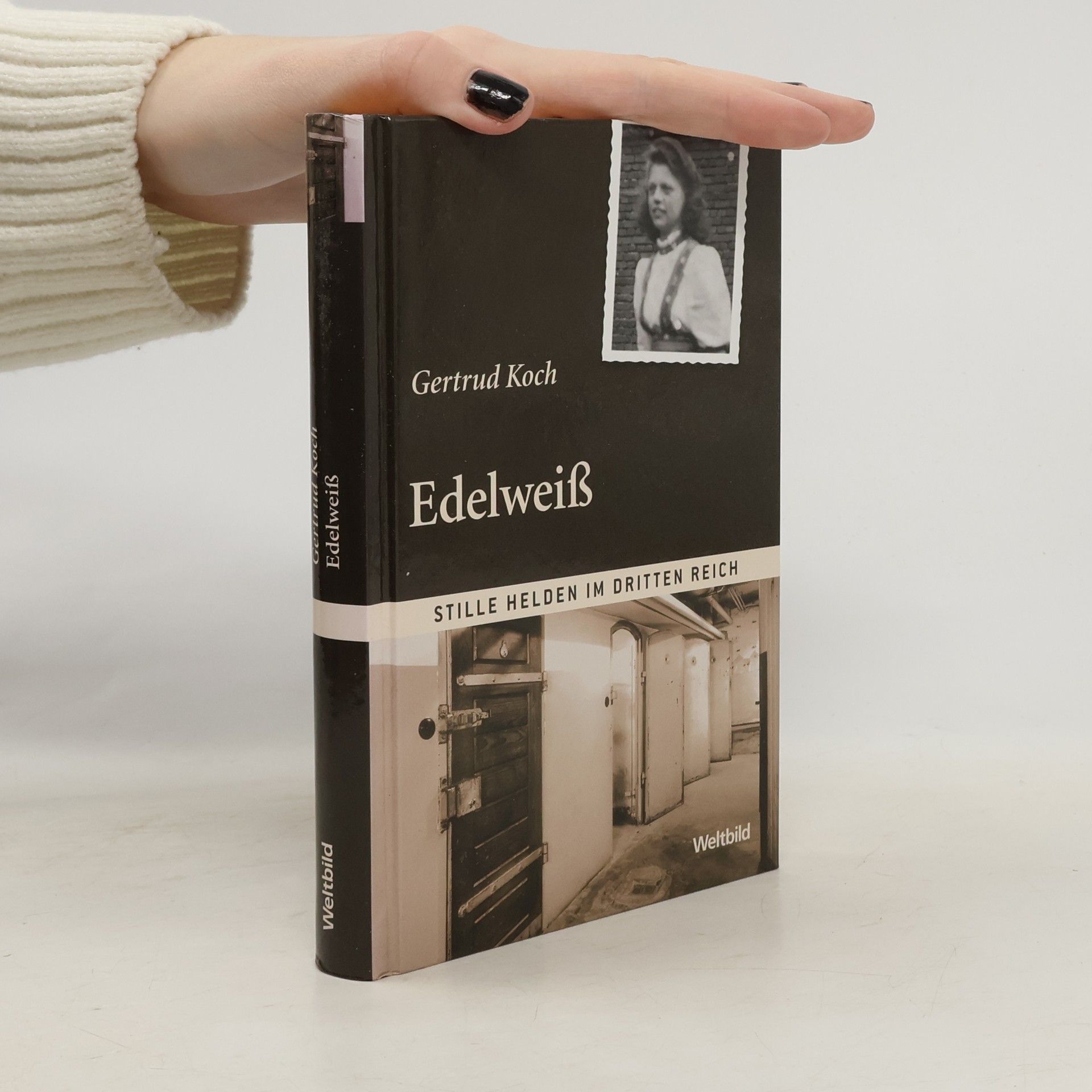Ein (un) berechenbares Handwerk
- 256 Seiten
- 9 Lesestunden
W. G. Schmidt explores the culturalization of musical-cosmic laws in the Baroque period and their impact on subsequent eras. U. Leuschner examines Johann Heinrich Merck's blending of genres. M. Willems discusses the detrimental effects of principles on artistic genius, reflecting on the sociogenesis of the autonomy concept in art and its paradoxes. A. Schmitt argues that the theory of beauty in genius aesthetics ultimately transforms into epistemology. H. R. Brittnacher critiques Schiller's dismissal of popular culture. M. Bies critiques the factory system, highlighting the relationship between art and craftsmanship in Goethe's work. L. Korten investigates the logic of emotion in relation to genius and metrics from 1770 to 1800. R. Ascarelli analyzes the practice of psalm translations and the deregulation of poetry, focusing on Thomas von Schoenfeld. J. Freytag reflects on authorship in J. M. R. Lenz's dramatic sketch "Pandämonium Germanikum." M.-C. Wilm discusses aesthetic programming and poetic craftsmanship in Lenz and Schiller's works. B. Hamacher addresses genius and creativity post-"end of art," considering Hegel and Schelling's influence. G. Oesterle presents a communal and intermedial writing workshop. O. Briese delves into the literary group "Der Tunnel über der Spree" and the young Theodor Fontane. M. Kagel explores themes of intolerance, memory, and intervention in George Tabori's reception of Lessing.