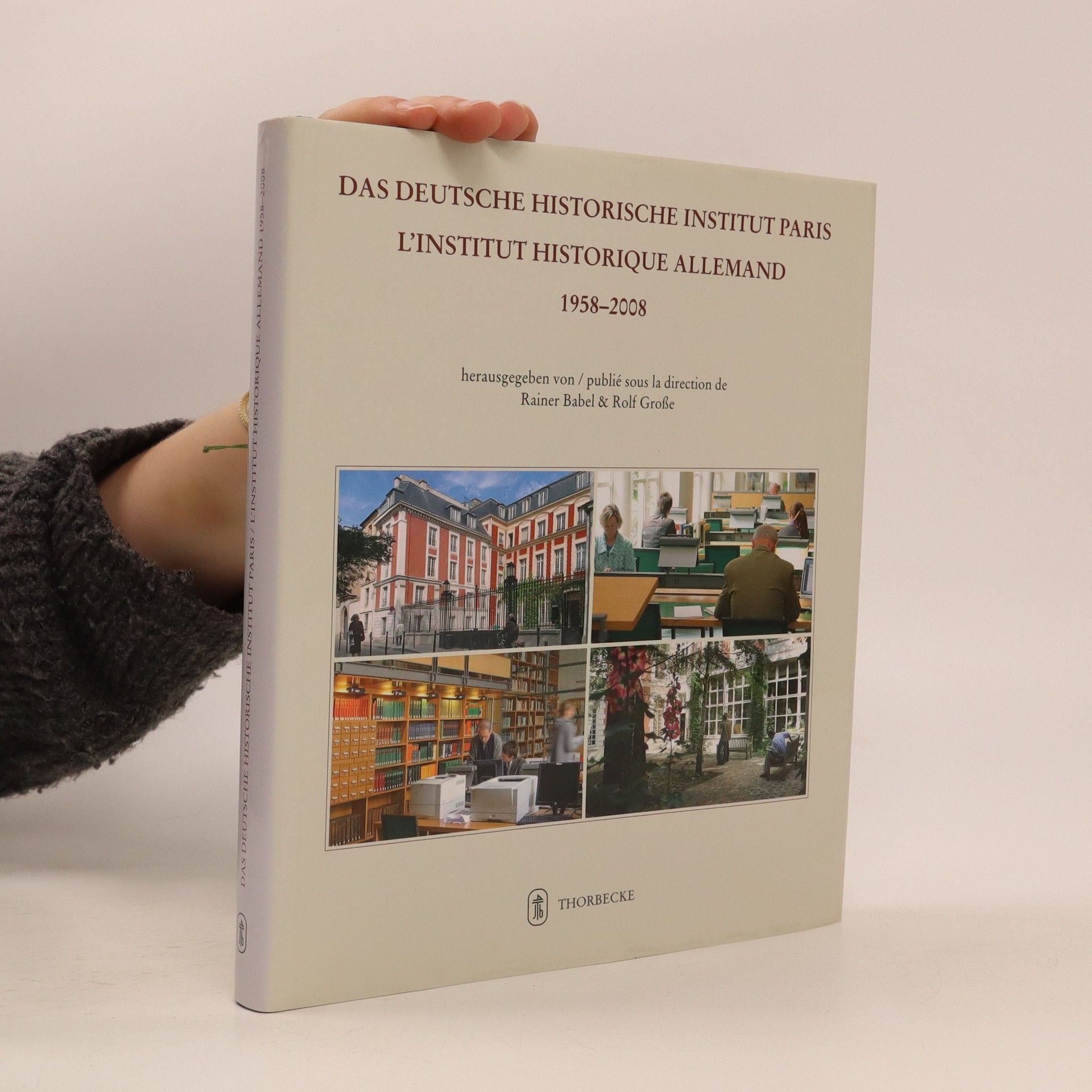Franz I.
- 304 Seiten
- 11 Lesestunden
Franz I. (1494-1547) holte Leonardo da Vinci samt der Mona Lisa nach Frankreich – er gilt als Begründer der französischen Renaissance. Doch die Bilanz seiner Herrschaft erschöpft sich mitnichten im Bild des Kunstmäzens und Gelehrtenfreundes. Erbittert rang Franz I. mit seinem Gegenspieler Karl V. um die Vorherrschaft in Europa. Im eigenen Land beförderte er die Zentralisierung der Macht in Paris. Im Leben des »Ritterkönigs« verdichten sich entscheidende Entwicklungslinien nicht nur der französischen, sondern der gesamteuropäischen Geschichte des 16. Jahrhunderts: die Entfaltung neuer kultureller Orientierungen, die fortschreitende Konsolidierung von Staatsgebiet und Staatsgewalt sowie die Auseinandersetzung mit der beginnenden Glaubensspaltung. Rainer Babel, Historiker am Deutschen Historischen Institut in Paris und Spezialist für französische Geschichte der Frühen Neuzeit, schafft ein lebendiges Bild des Renaissancekönigs vor dem Hintergrund der gesamteuropäischen Entwicklungen.