Offering realistic and ethical solutions to global issues, the book fosters dialogue between progressives and conservatives in a polarized America. Its original and thought-provoking approach is both concise and reasoned, encouraging readers to engage with its content fully, including the insightful introduction. Additionally, it features a bonus supplement highlighting entrepreneurs in film, adding a unique perspective to its discussions.
Gerald Schneider Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

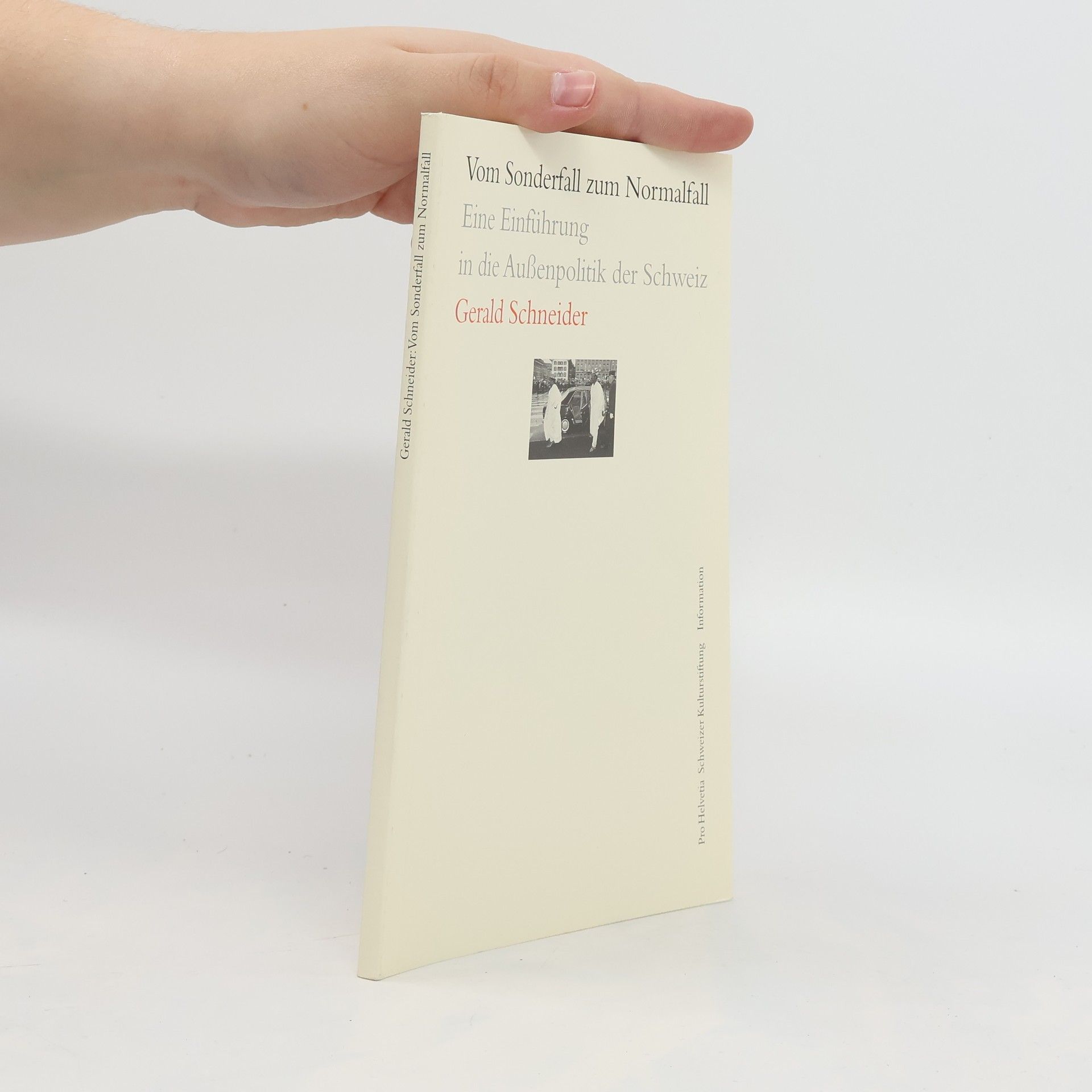
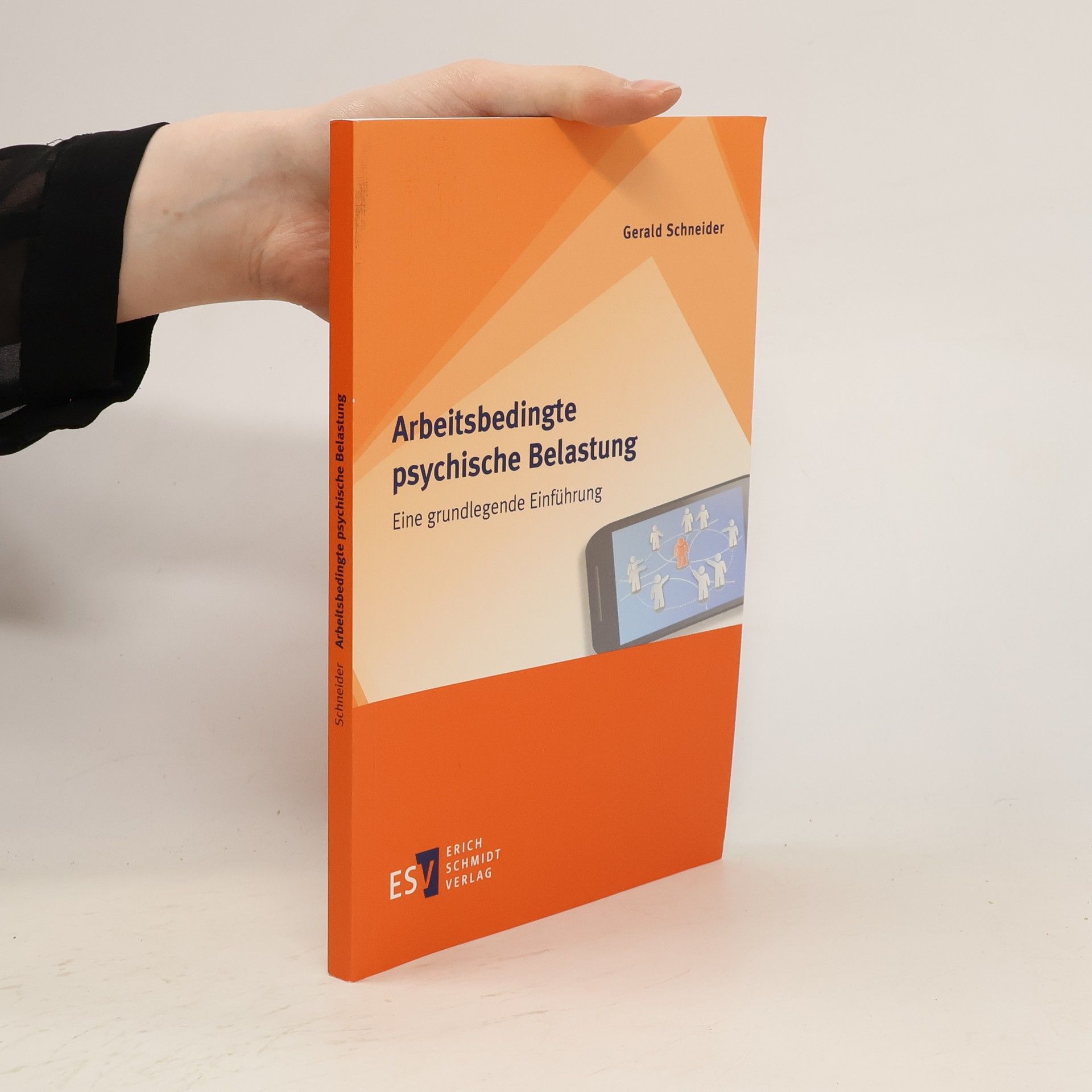
Arbeitsbedingte psychische Belastung
Eine grundlegende Einführung
Psychische Belastungen sind im modernen Arbeitsleben von großer Bedeutung. Schnelle Veränderungen, Zeitdruck und unzureichende Führung prägen den Arbeitsalltag zunehmend, oft mehr als körperliche Belastungen. Dies führt zu einem Anstieg psychisch bedingter Ausfallzeiten, wobei auch private Belastungen eine Rolle spielen. Eine einfache Zuordnung zu beruflichen Tätigkeiten greift zu kurz. Dennoch sind viele berufliche Fehlbelastungen regulierbar, was psychisch gesundes Arbeiten ermöglicht und sowohl den Gesundheitsinteressen der Mitarbeiter als auch den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen zugutekommt. Gesunde Mitarbeiter zeigen höhere Leistungsbereitschaft und Firmenidentifikation, was eine Win-Win-Situation schafft. Um psychisch gesunde Arbeitsbedingungen zu fördern, benötigen Arbeitgeber, Führungskräfte und Arbeitnehmervertreter fundiertes Fachwissen. Die Deutsche Arbeitsschutzstrategie hat wichtige Themen benannt, jedoch fehlt es an konkretem Wissen. Dieses Buch schließt diese Lücke, indem es die Qualifizierungsempfehlungen inhaltlich ausgestaltet und eine allgemeine Wissensbasis für alle im Betrieb Beteiligten schafft. Es behandelt die Verbreitung psychischer Belastungen, Gestaltung psychisch gesunder Arbeit, Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen zur Wahrung gesunder Arbeitsplätze. Der Verzicht auf notwendiges Vorwissen macht es für alle Leser, einschließlich interessierter Laien, verständlich und zugänglich. Leser kö