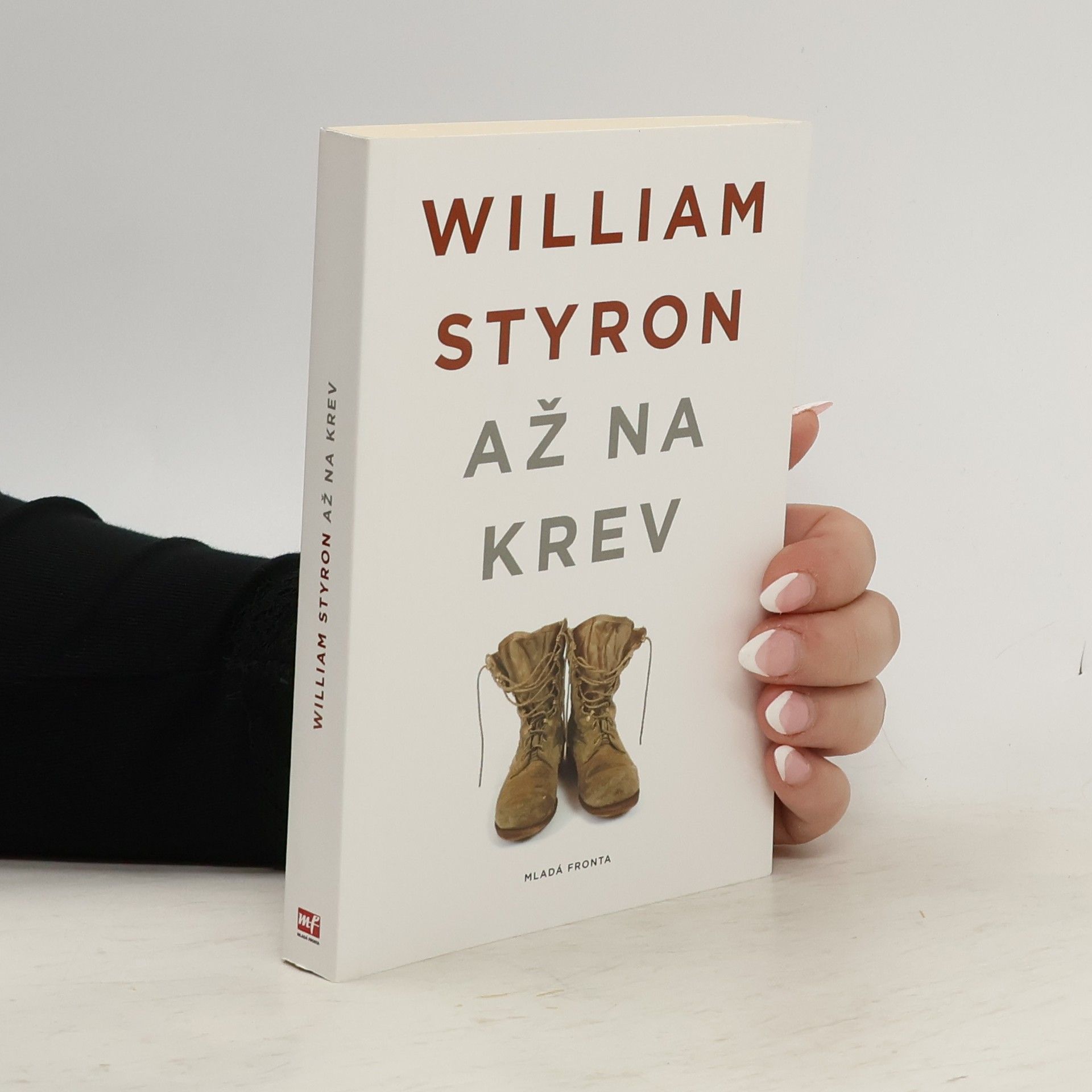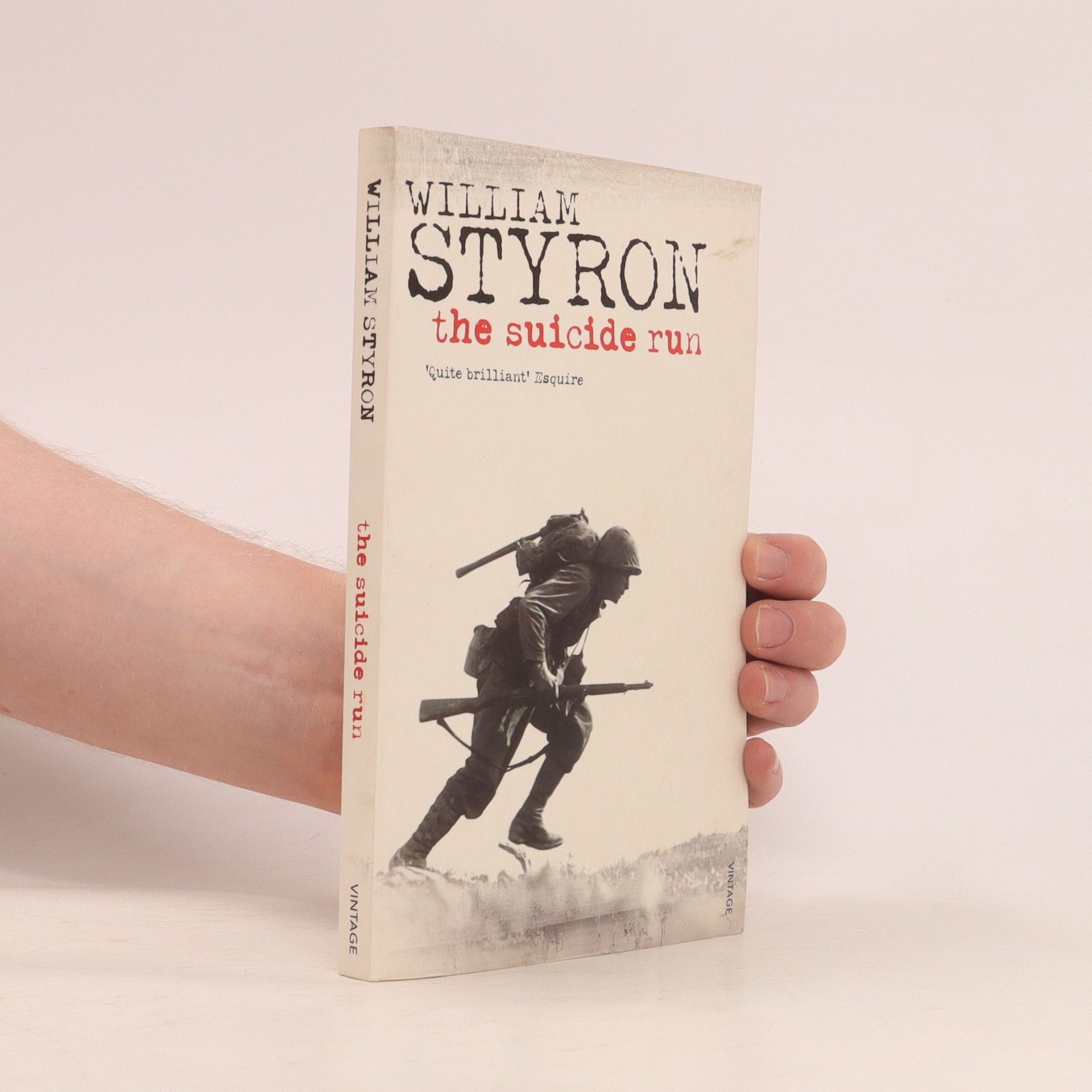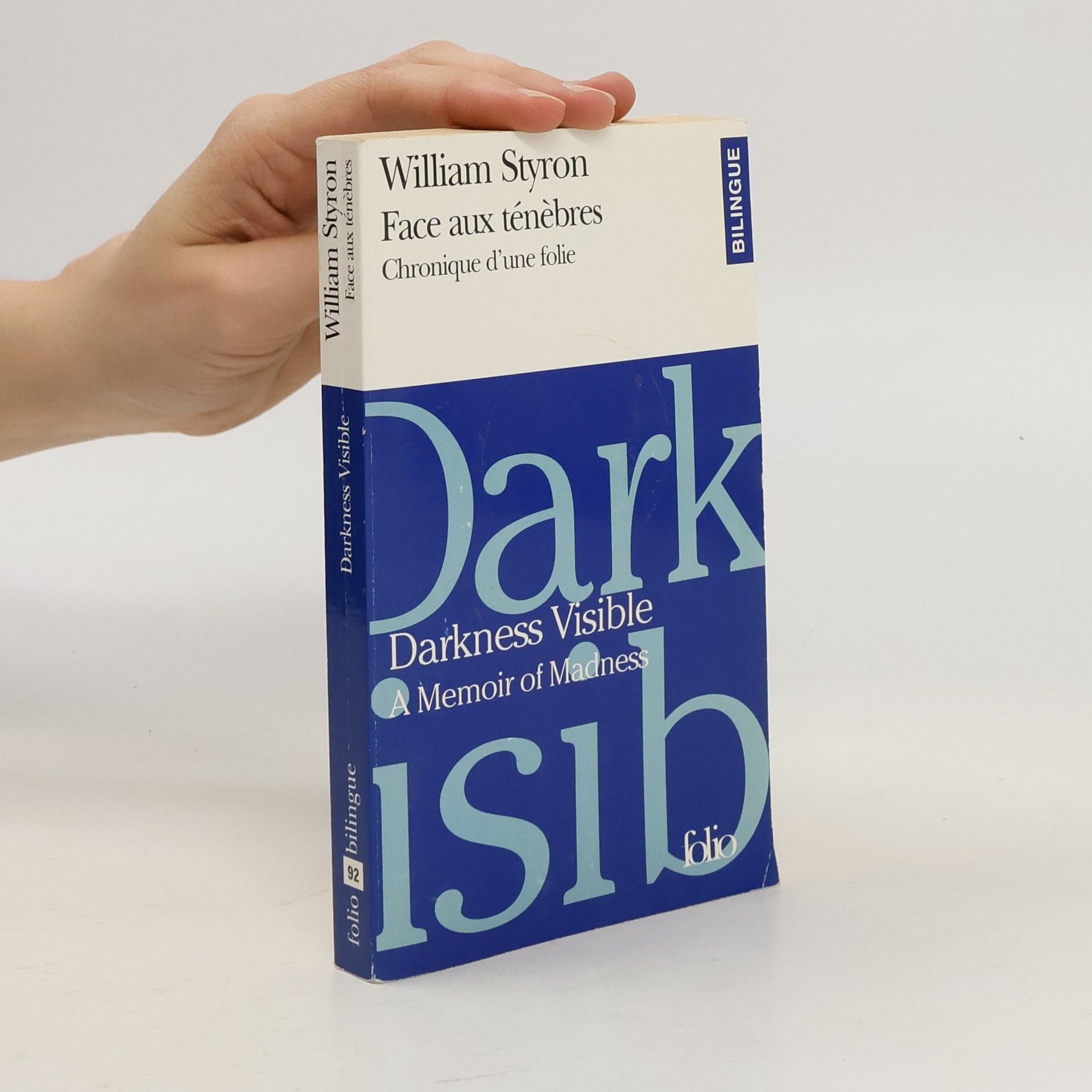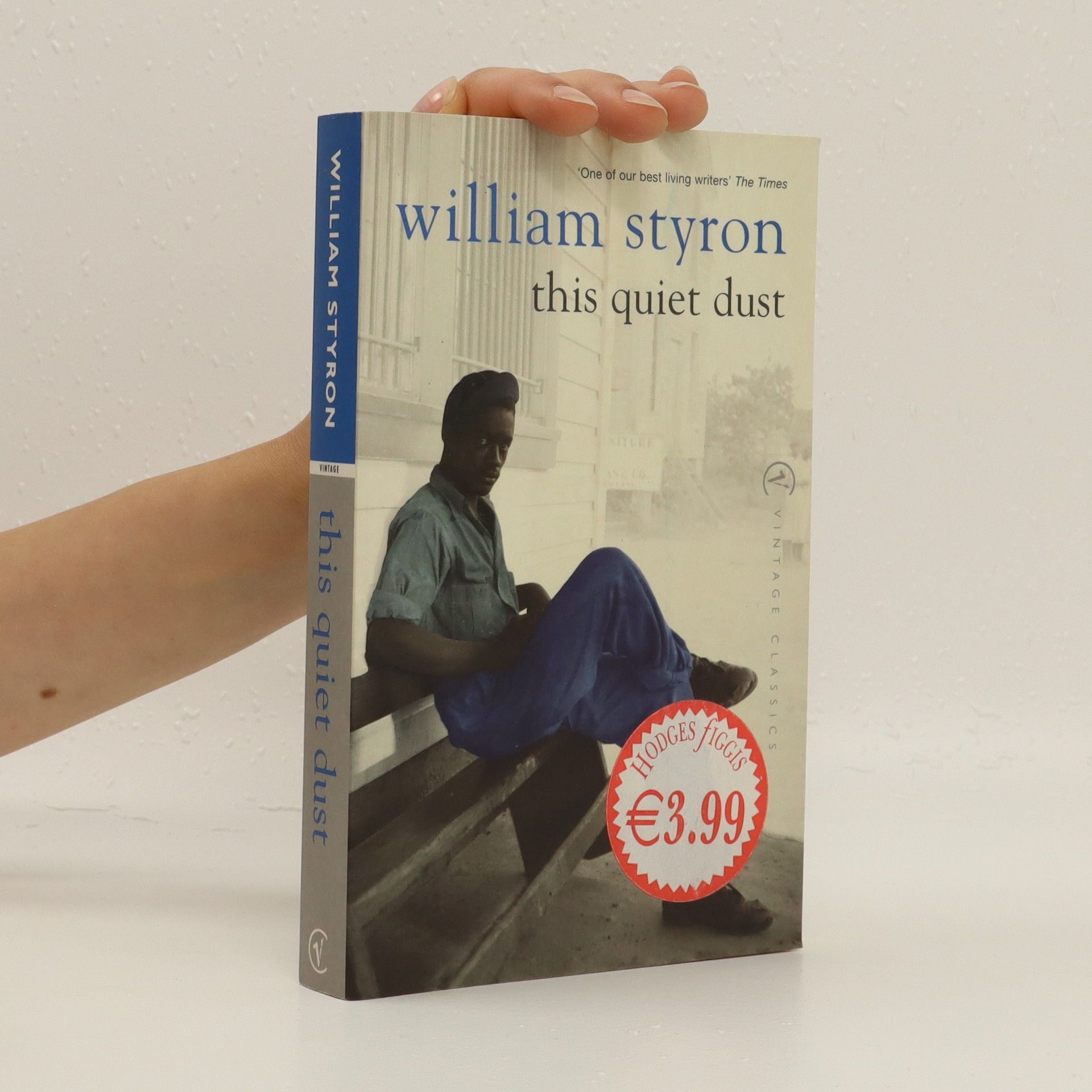PRZEŁOMOWE, DO BÓLU PRAWDZIWE, ŚWIADECTWO WALKI Z DEPRESJĄ Depresja to powszechne zaburzenie psychiczne, które dotyka setek milionów osób na całym świecie niezależnie od płci i wieku. Połowa z nich miewa myśli samobójcze, a jedna piąta skutecznie odbiera sobie życie. Ciemność widoma. Pamiętnik o szaleństwie to pozycja wybitna, zarówno w kategoriach literackich, jak i psychologicznych, dziś uważana za jedną z najważniejszych osobistych relacji ludzi cierpiących na depresję. Opowieść o życiu w mrokach udręczonego umysłu i o sposobach wychodzenia z tego stanu przyczyniła się wydatnie do nagłośnienia choroby, wokół której zawsze panowało kłopotliwe milczenie. Styron wpuścił czytelnika w dramatyczny świat swojego pogrążonego w depresji umysłu i ze wstrząsającą dosłownością opisał własne cierpienia. Fascynujący i wstrząsający portret wyniszczającej choroby… – „The New York Times”
William Styron Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
William Styron zählte zu den herausragendsten amerikanischen Schriftstellern seiner Generation. Seine Werke, oft kontrovers und preisgekrönt, befassten sich mit tiefgreifenden menschlichen Dramen und moralischen Dilemmata. Styron war bekannt für seinen scharfen Einblick in die dunklen Seiten der menschlichen Psyche und gesellschaftliche Fragen. Sein Schreiben zeichnete sich durch einen starken erzählerischen Stil und die Fähigkeit aus, starke Emotionen bei den Lesern hervorzurufen.


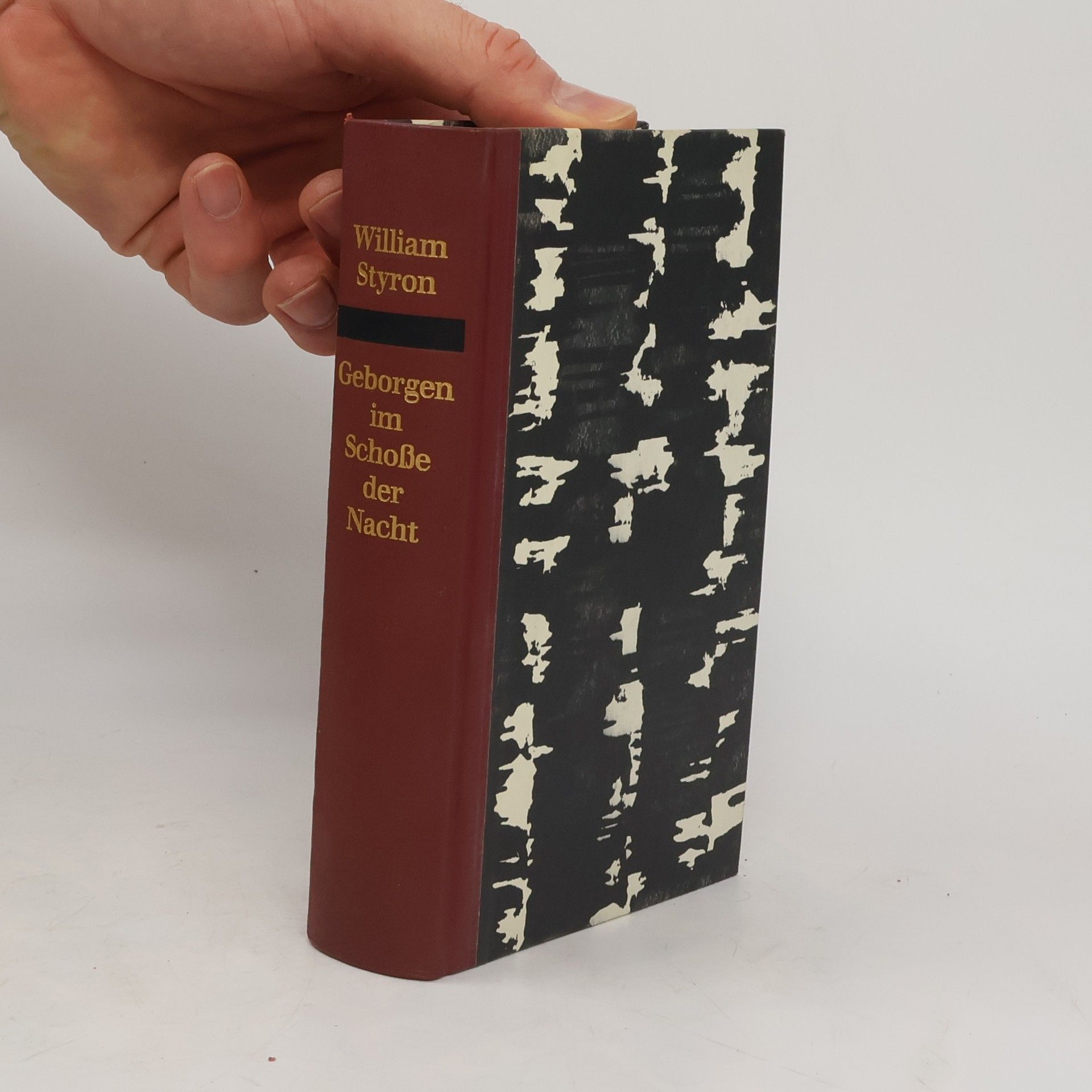


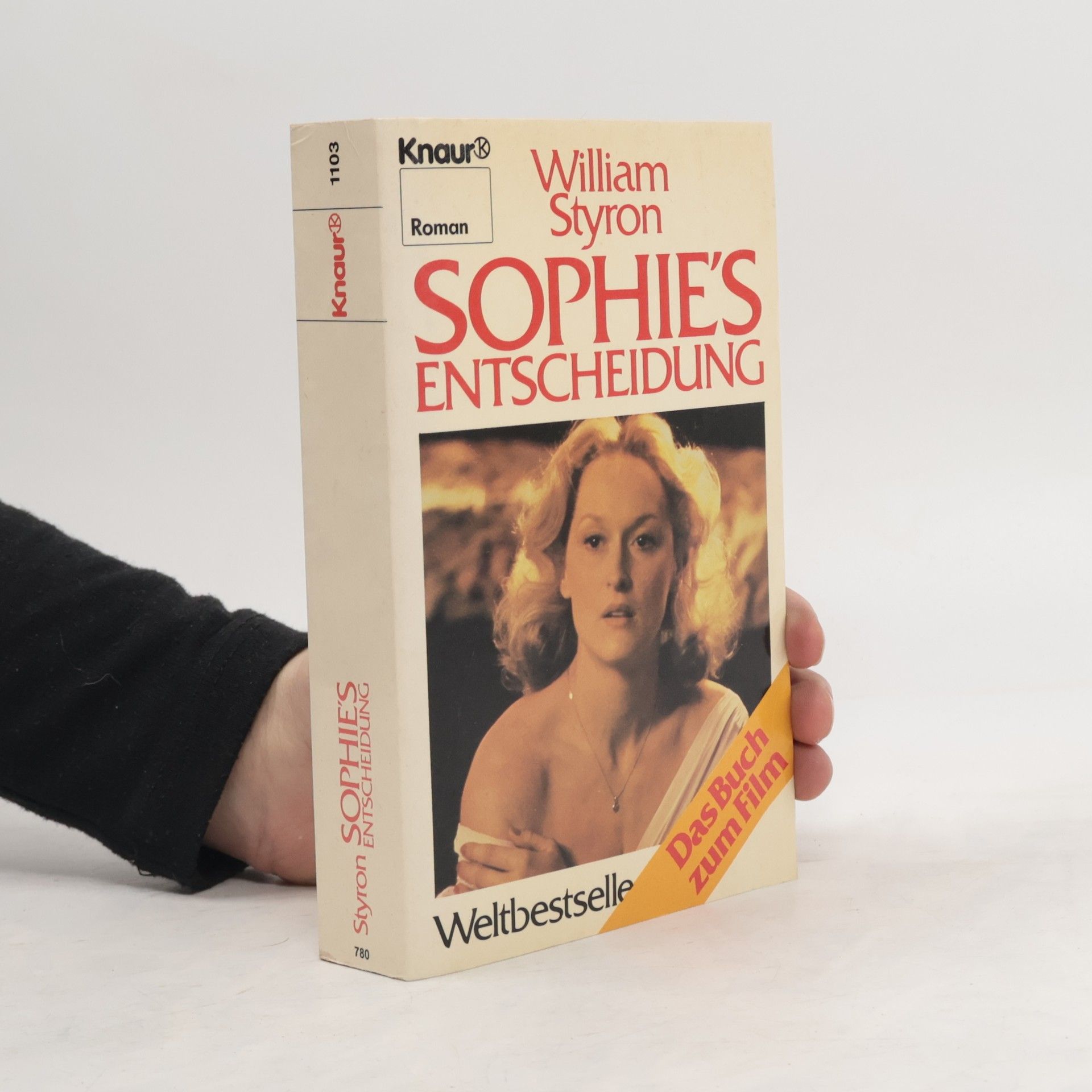

Depression
- 96 Seiten
- 4 Lesestunden
How does a writer compose a suicide note? This was not a question that the prize-winning novelist William Styron had ever contemplated before. In this true account of his depression, Styron describes an illness that reduced him from a successful writer to a man arranging his own destruction. He lived to give us this gripping description of his descent into mental anguish, and his eventual success in overcoming a little-understood yet very common condition.The unabridged text of Darkness Visibleby William StyronVINTAGE MINIS- GREAT MINDS. BIG IDEAS. LITTLE BOOKS.A series of short books by the world's greatest writers on the experiences that make us humanAlso in the Vintage Minis series-Swimming by Roger DeakinBabiesby Anne EnrightCalm by Tim ParksWork by Joseph Heller
Až na krev: Pět povídek o námořní pěchotě
- 272 Seiten
- 10 Lesestunden
Povídky Williama Styrona spojuje téma osamělosti intelektuálně založeného jedince, který je přinucen změnit své návyky a ocitne se náhle v prostředí, jež je mu bytostně cizí. Styron zpracoval v pěti povídkách především své osobní zkušenosti: první získal v období druhé světové války, kdy přerušil studia a byl odveden do řad námořní pěchoty, ale dříve než mohl se svou jednotkou zasáhnout do bojů, Japonsko kapitulovalo. Podruhé Styron narukoval k téže zbrani jako rezervista na počátku padesátých let, kdy probíhala válka na korejském poloostrově. Ani tady se žádných bitev nezúčastnil, přesto však dokázal sugestivně zachytit smrtelný strach, jenž ho prostoupil ve chvílích, kdy hrozilo bezprostřední nasazení do probíhajících konfliktů. V silných, pacifistických příbězích Styron přesvědčivě dokumentuje, jak brutálním a ubíjejícím způsobem mohou působit na povahu vzdělaného člověka dimenze vojenského života, jimž se přizpůsobuje jen s největším sebezapřením. Na druhé straně ovšem konstatuje, že v souboji se zlem je zapotřebí přinášet oběti a snad i proto se v jedné z próz přiznává, že „přes averzi ke všemu vojenskému shledávám na životě vojáka všelicos přijatelného a dokonce fascinujícího“.
Cinq nouvelles de Styron publiées de façon posthume, écrites à des dates très différentes et qui, pourtant, forment un tout cohérent tant elles sont inspirées par la vie et les préoccupations centrales de l'auteur. "A tombeau ouvert" et "Marriott le marine" ont été conçues comme les chapitres de deux romans que Styron abandonnera pour écrire Le choix de Sophie. L'auteur y évoque son traumatisme d'avoir été rappelé sous les drapeaux après la Seconde Guerre mondiale, pour se battre en Corée. Dans "La maison de son père", le narrateur n'en revient pas d'avoir survécu à la guerre du Pacifique, il en éprouve un mélange d'euphorie et de culpabilité... A lire de tels textes, on mesure l'impact qu'eut la Seconde Guerre mondiale sur des millions d'Américains; on comprend aussi la place immense, quasi obsessionnelle, qu'occupe dans l'oeuvre du romancier l'expérience de la guerre et de la vie militaire. C'est le livre tout entier qui restitue l'idée d'héroïsme, mais aussi le drame et le sens de l'absurdité qui changèrent à tout jamais ces hommes engagés dans le corps des Marines.
The Suicide Run
- 208 Seiten
- 8 Lesestunden
The five personal and intensely powerful tales that make up this collection draw upon William Styron's real-life experiences in the US Marine Corps, and give us an insight into the early life of one of America's greatest modern writers. The stories are set in the gruelling camps and sweltering training fields which mark the limbo point between civilian life and the horrors of war. The stories tell of young men embarking on suicidal 1000 mile roundtrips to New York to see their girlfriends on 36 hour leave periods; the surreal experience of being conscripted for a second time to serve in the Korean War; and the frustration and isolation of returning home when service is over. The Suicide Run brings to life the drama, inhumanity, absurdity and heroism that forever changed the men who served in the Marine Corps.
Face aux ténèbres. Darkness Visible
- 221 Seiten
- 8 Lesestunden
"Mr. Styron's description of his climactic night of 'despair beyond despair' moved me (a healthy, nondepressive personality) to the point that I felt I was facing my own death. Here is an example of art refined in the fire of experience: the writing is so pure one is hardly aware of the ink on the page." —Edmund Morris In the summer of 1985, William Styron was overtaken by persistent insomnia and a troubling sense of malaise—the first signs of a deep depression that would engulf his life and leave him on the brink of suicide. In Darkness Visible a great novelist describes his devastating descent into depression, taking us on an unprecedented journey into the realm of madness. Expanded from his celebrated Vanity Fair piece, this moving memoir is an intimate portrait of the agony of Styron's ordeal, as well as a probing look at an illness that affects millions but is still widely misunderstood. "To most of those who have experienced it," Styron writes, "the horror of depression is so overwhelming as to be quite beyond expression." Through Styron's remarkable candor and powers of description, we come truly to understand the anguish of a mind desperate unto death. We are moved yet not depressed by his account: with him, we feel uplifted by a sense of catharsis and can at last begin to fathom depression's dark reality.
The first non-fiction titles from William Styron which addresses great moral issues with passion and precision. His writing is at once meditative and engaged, personal and erudite, whether he is covering the greats of American literature, or exploring the nature of the American South. Throughout, Styron's warmth, humour and candour, coupled with a refusal to judge, make for stirring and stimulating reading.
A tidewater morning
- 160 Seiten
- 6 Lesestunden
In this brilliant collection of "long short stories," the Pulitzer Prize-winning author of Sophie's Choice returns to the coastal Virginia setting of his first novels. Through the eyes of a man recollecting three episodes from his youth, William Styron explores with new eloquence death, loss, war, and racism. "From the Trade Paperback edition.
W sierpniu 1831 roku, w odległym zakątku południowo-wschodniej Wirginii, nastąpił jedyny skuteczny, zorganizowany bunt w dziejach niewolnictwa Murzynów amerykańskich. Początkowy ustęp niniejszej książki, zatytułowany "Do publiczności", jest przedmową do jedynego ważnego dokumentu współczesnego związanego z tym powstaniem - krótkiej, liczącej około dwudziestu stron broszury, nazwanej "Wyznania Nata Turnera", a opublikowanej w Richmondzie na początku roku następnego, której fragmenty włączono do tej książki. W opowieści, jaka potem następuje, rzadko odchodziłem od z n a n y c h faktów na temat Nata Turnera oraz buntu, którego był przywódcą. Jednakże w tych dziedzinach, w których jest mało wiadomości o Nacie, początkowym okresie jego życia i pobudkach powstania (a wiadomości takich najczęściej brakuje), pozwoliłem sobie na całkowitą swobodę wyobraźni przy rekonstruowaniu wydarzeń - utrzymując się mimo to, jak ufam, w granicach tej skąpej wiedzy o instytucji niewolnictwa, jaką pozostawiła nam historia. Względność czasu dopuszcza elastyczne określenia; rok 1831 był jednocześnie i dawno temu, i zaledwie wczoraj. Czytelnik może zechce wyciągnąć jakiś morał z tej opowieści, ale moim zamierzeniem była próba odtworzenia człowieka i jego epoki oraz napisania utworu, który jest nie tyle "powieścią historyczną" w konwencjonalnym sensie, co rozmyślaniem na temat historii.