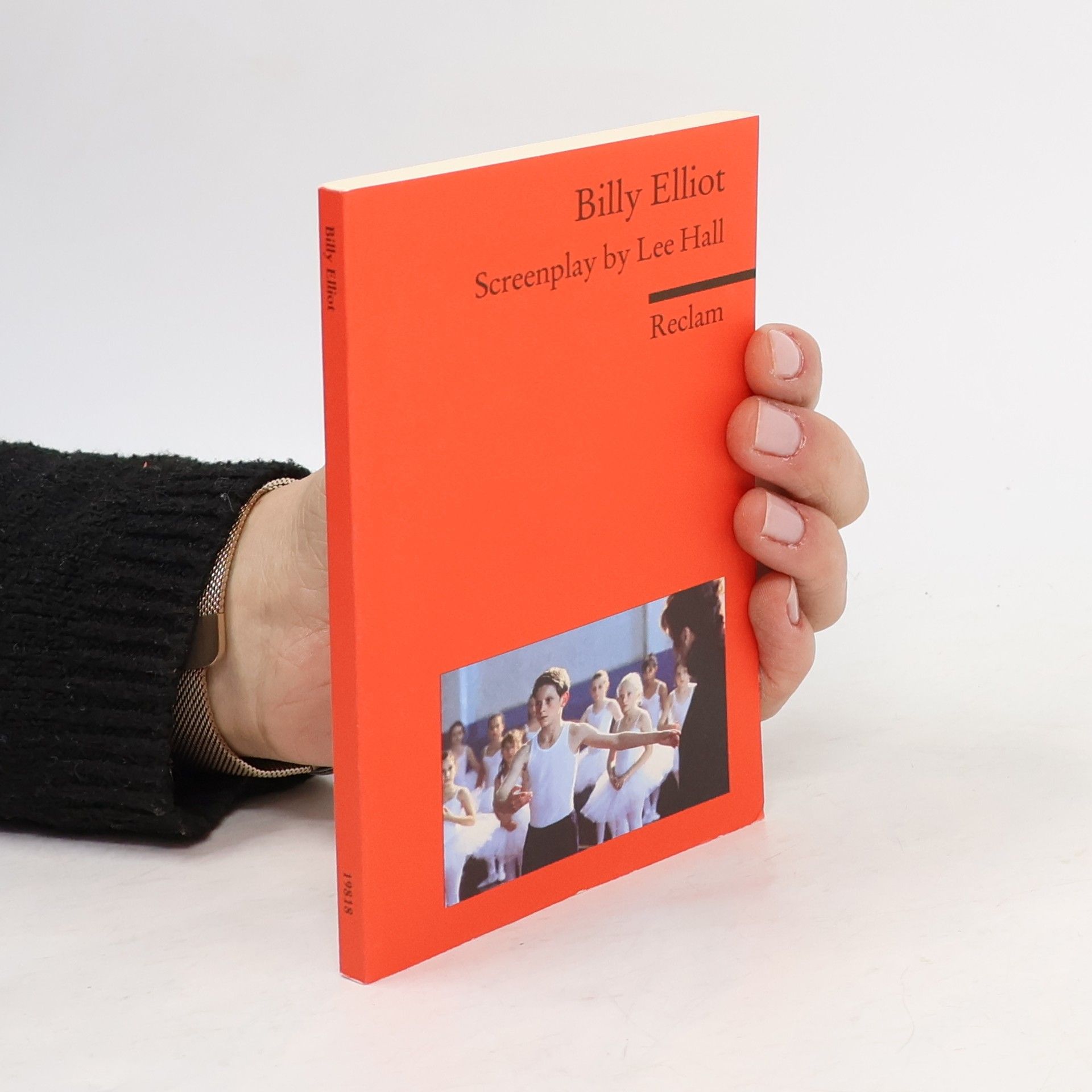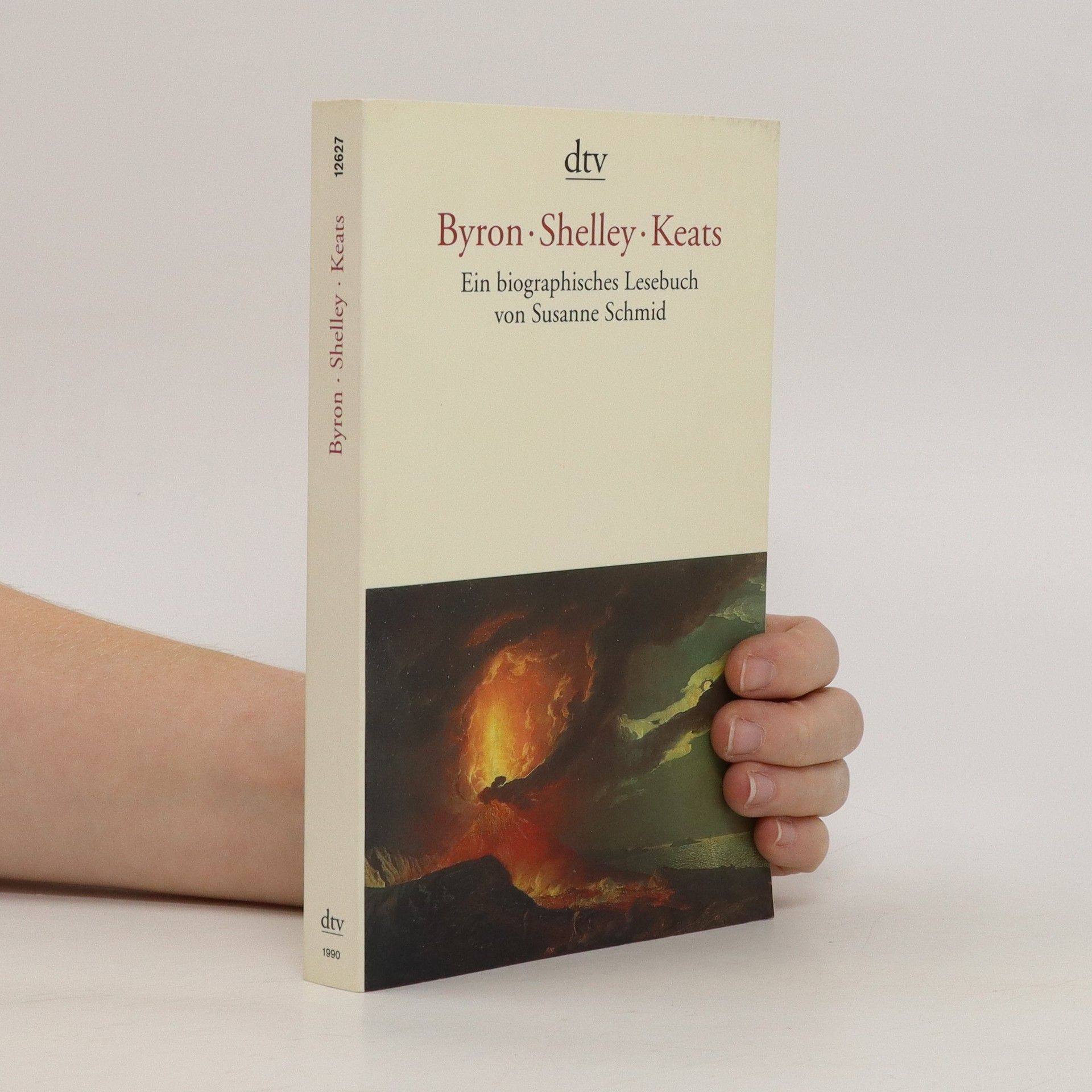Byron. Shelly. Keats. Ein biographisches Lesebuch.
- 324 Seiten
- 12 Lesestunden
Keine zweite Gruppe von Dichtern gab der Nachwelt Anlaß zu so reicher Mythenbildung wie diese drei jungverstorbenen englischen Romantiker: Der skandalumwitterte Exzentriker Lord Byron, Percy Shelley, der als radikaler Reformer für die Ideale der französischen Revolution eintrat, und der zarte Träumer John Keats. Dieses biographische Lesebuch schildert - illustriert mit zahlreichen originalsprachigen Textdokumenten und kongenialen Nachdichtungen - das Leben der drei schillerndsten Persönlichkeiten in einer stürmisch bewegten Epoche.