Deutschland in der Weltwirtschaft
- 232 Seiten
- 9 Lesestunden



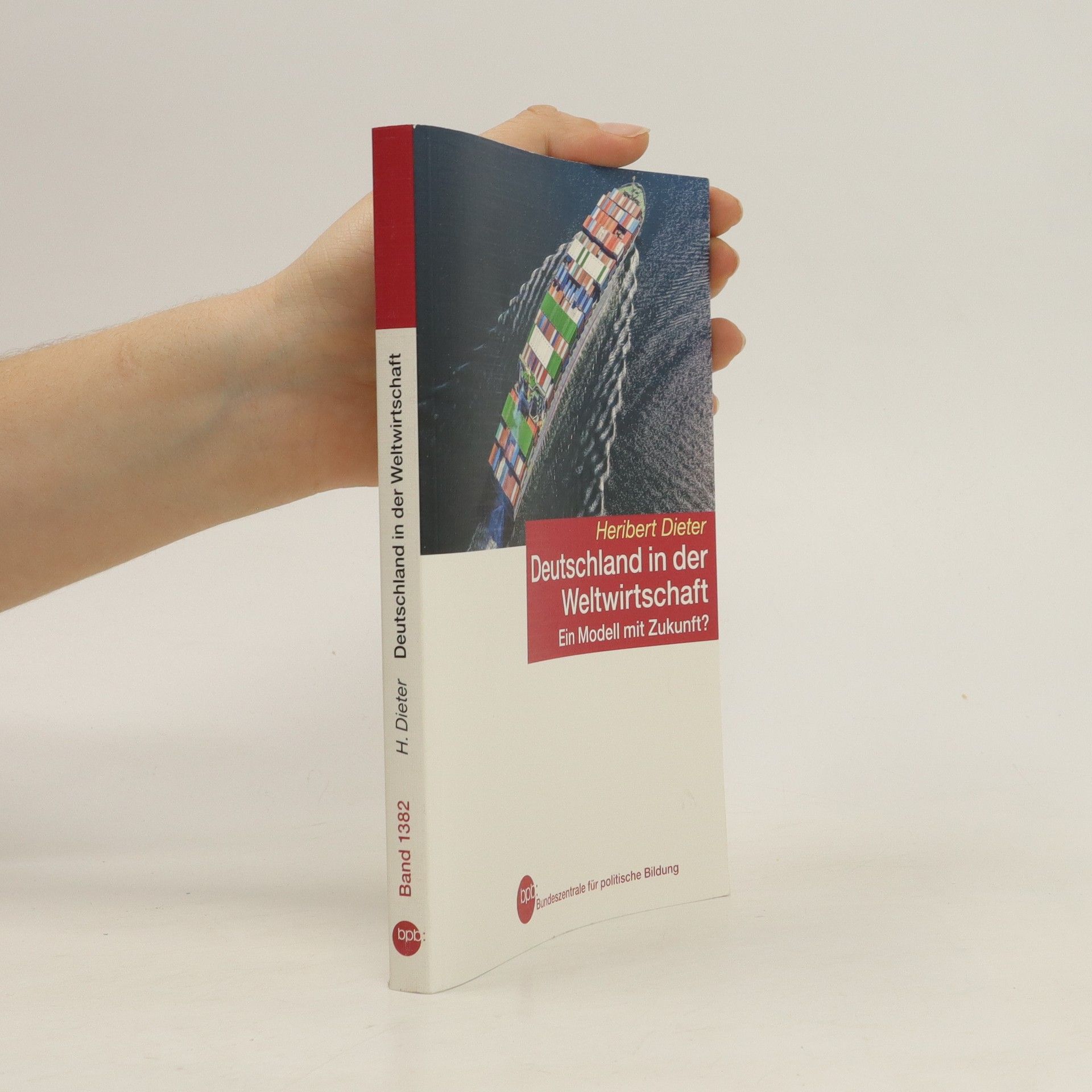
Die Bewunderung für den rasanten Aufstieg Chinas in der globalen Wirtschaftsordnung weicht zunehmend der Sorge vor einer autoritären Weltmacht. Heribert Dieter zeigt auf, wie China die Rolle der "Werkbank" überwunden hat und weltwirtschaftliche Strukturen verändert. Er analysiert die wirtschaftliche und politische Entwicklung des Landes aus der Perspektive der internationalen politischen Ökonomie und deren globale Folgen. Mit der Belt-and-Road Initiative, auch bekannt als die Neue Seidenstraße, strebt Peking an, seine angeschlagenen Staatsunternehmen zu stärken und neue wirtschaftliche Abhängigkeiten zu schaffen. Unter Generalsekretär Xi Jinping wird eine offensivere Innen- und Außenpolitik sichtbar, besonders in Hong Kong. Die umfassende Kontrolle der Bevölkerung und der Umgang mit Minderheiten verdeutlichen Pekings Machtbewusstsein, während Werte wie Bürgerbeteiligung und Menschenrechte in den Hintergrund gedrängt werden. Die COVID-19-Pandemie, die ihren Ursprung in China hat, verstärkt den Trend zur Selbstisolation. Trotz des Macht- und Wohlstandszuwachses könnte die enorme Verschuldung des Landes eine größere Wirtschaftskrise oder ein deutliches Abschwächen des Wachstums zur Folge haben. Beide Szenarien würden erhebliche Auswirkungen auf alle mit China verflochtenen Volkswirtschaften haben und machen eine Analyse der aktuellen Bedingungen umso wichtiger.
Ursachen, Konsequenzen und die Rolle des Internationalen Währungsfonds
Die Asienkrise von 1997 überraschte sowohl Akteure in Südost- und Ostasien als auch weltweit. Was einst als wirtschaftliches Wunder galt, verwandelte sich in einen dramatischen Währungsabsturz, der Investitionen abziehen und das Weltfinanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs bringen sollte. In diesem Kontext werden interne und externe Ursachen sowie die Folgen der Krise analysiert. Das dynamische Wachstum der letzten dreißig Jahre führte zu einer Sorglosigkeit, die eine unzureichende Kontrolle des Finanzsystems und mangelnde Transparenz zur Folge hatte. Auch ausländische Akteure versagten, indem sie Kredite leichtfertig vergaben und dann abrupt zurückforderten. Besonders der Internationale Währungsfonds (IWF) spielte eine problematische Rolle: Er konnte die Krise nicht vorhersagen und trug nicht zur Stabilisierung bei, als Investoren sich zurückzogen. Stattdessen verschärfte der IWF die Situation durch pro-zyklische Fiskalpolitiken und verstärkte die gesamtwirtschaftliche Kontraktion. Die Krise wirft Fragen zur Strukturreform des IWF auf, der zwar Politik macht, aber nicht ausreichend von Parlamenten kontrolliert wird. Zudem erfüllt der IWF seine Kernaufgabe, die Stabilisierung von Wechselkursen, nicht. Über die IWF-Kritik hinaus könnte die Krise die Entwicklung eines asiatischen Wirtschaftsblocks fördern und somit den Beginn eines asiatischen Jahrhunderts markieren.