Viele Menschen spüren Sehnsucht nach etwas, das über den persönlichen Alltag hinausgeht. Den Zugang zu diesem alles vereinenden Bewusstsein versperrt uns ein elementares Glaubenssystem: unser „Ur-Credo“, aus dem sich unsere „trennende Identität“, unser Ich entwickelt hat. Dieses Buch zeigt den Weg zum Entdecken unseres „essentiellen Wertes“. Ein Beitrag zur Spiritualität.
Wolfgang Bernard Reihenfolge der Bücher
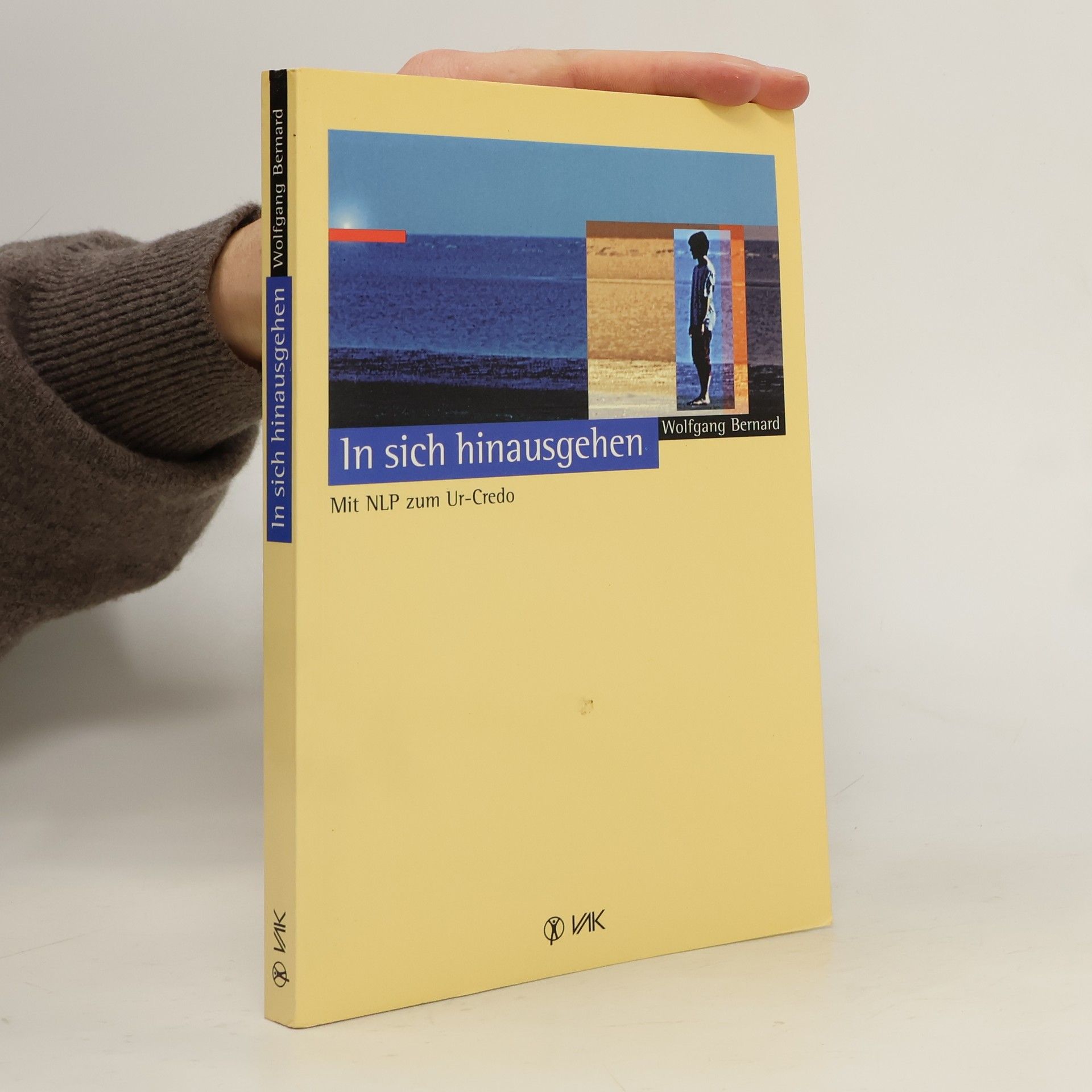
- 1996