Reinhart Kosellecks Einfluss auf die Begriffsgeschichte und die Analyse des politischen Totenkults wird umfassend beleuchtet. Der Band bietet einen tiefen Einblick in seine innovative Geschichtstheorie und die Auseinandersetzung mit 'historischen Zeiten'. Zudem wird seine Herangehensweise an historische Probleme und die spezifische Art des Denkens und Fragens analysiert. Die Besonderheiten seiner essayistischen Historik und das fortdauernde Potenzial seiner Ansätze zur Geschichtsschreibung werden herausgestellt, was seine Relevanz in den erinnerungspolitischen Debatten verdeutlicht.
Manfred Hettling Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
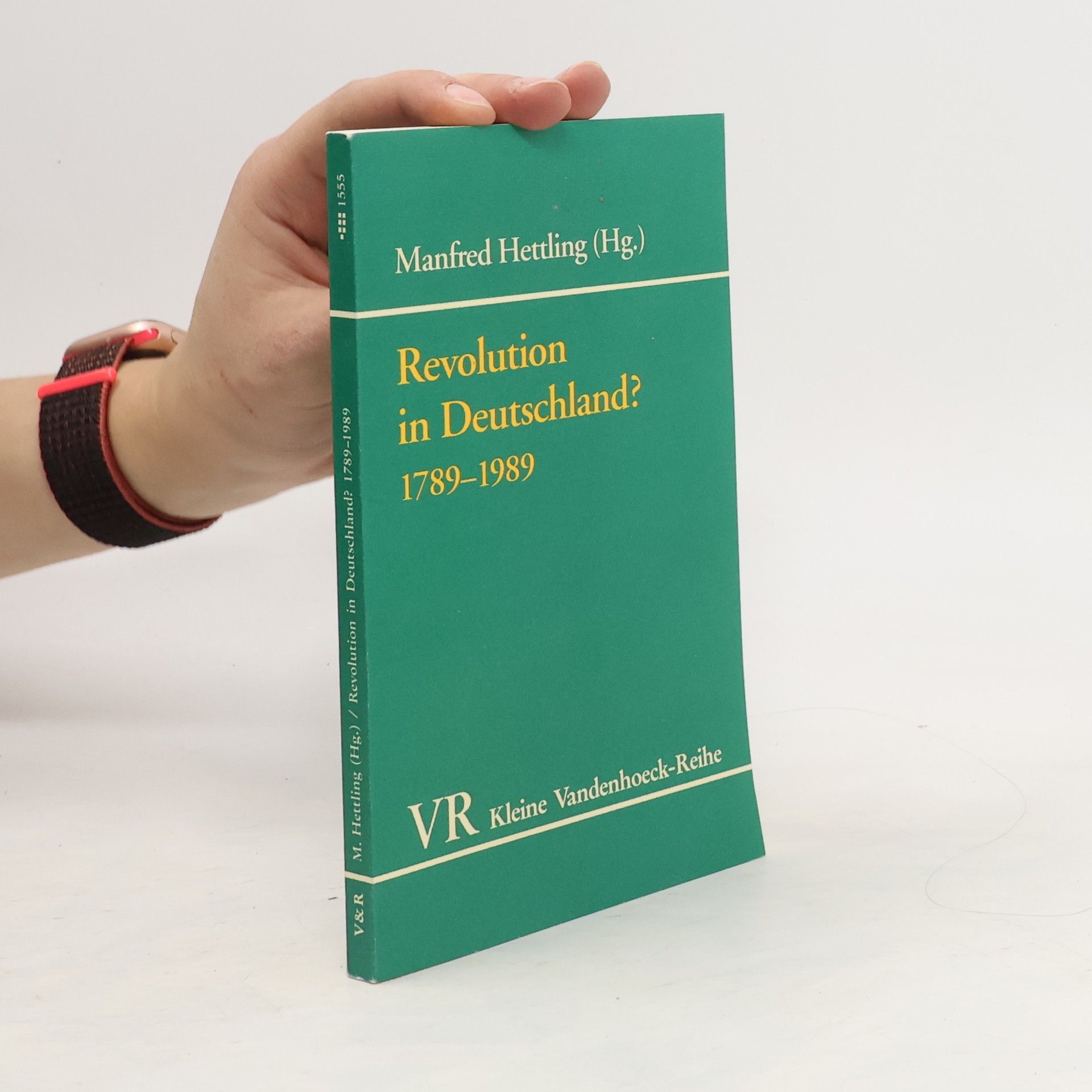
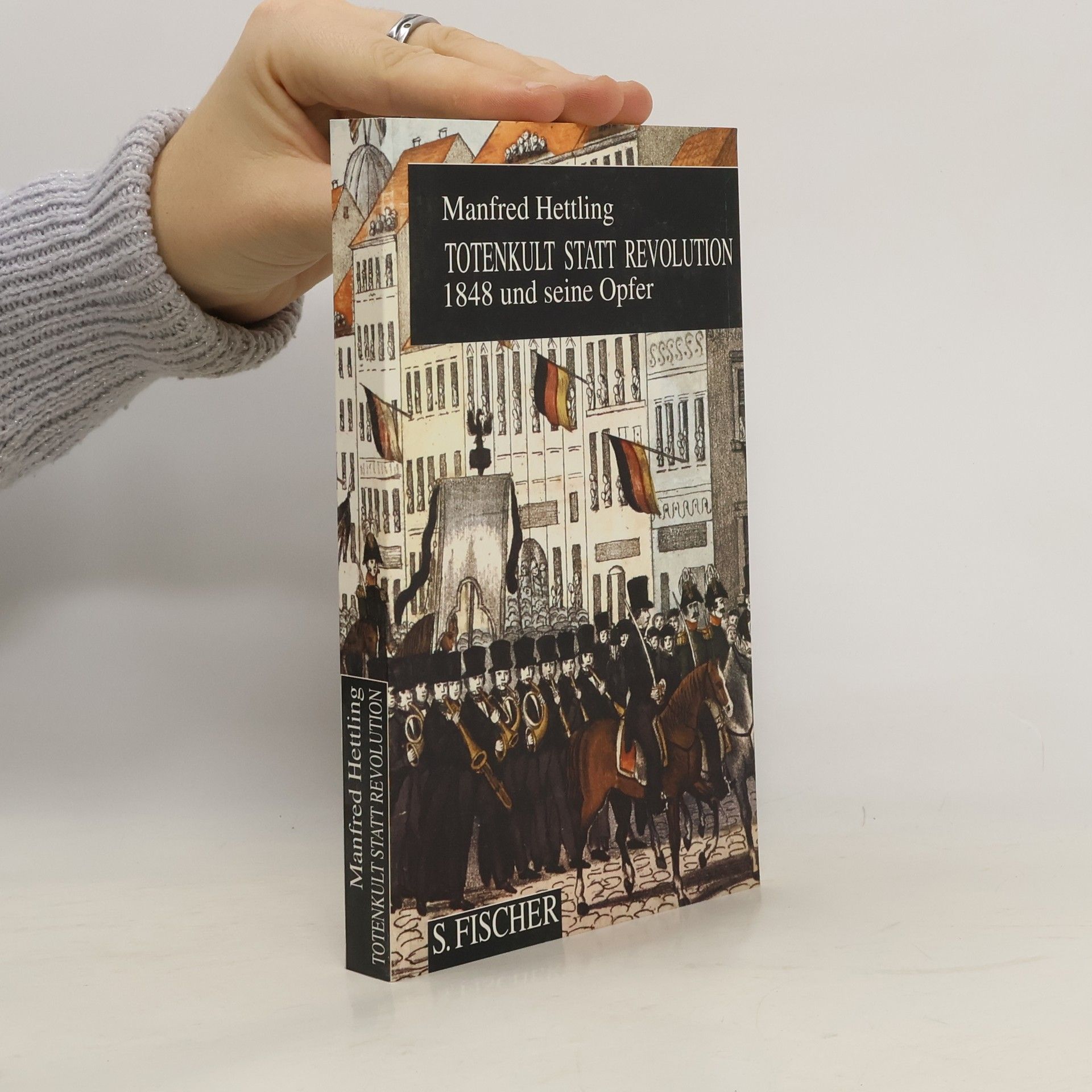

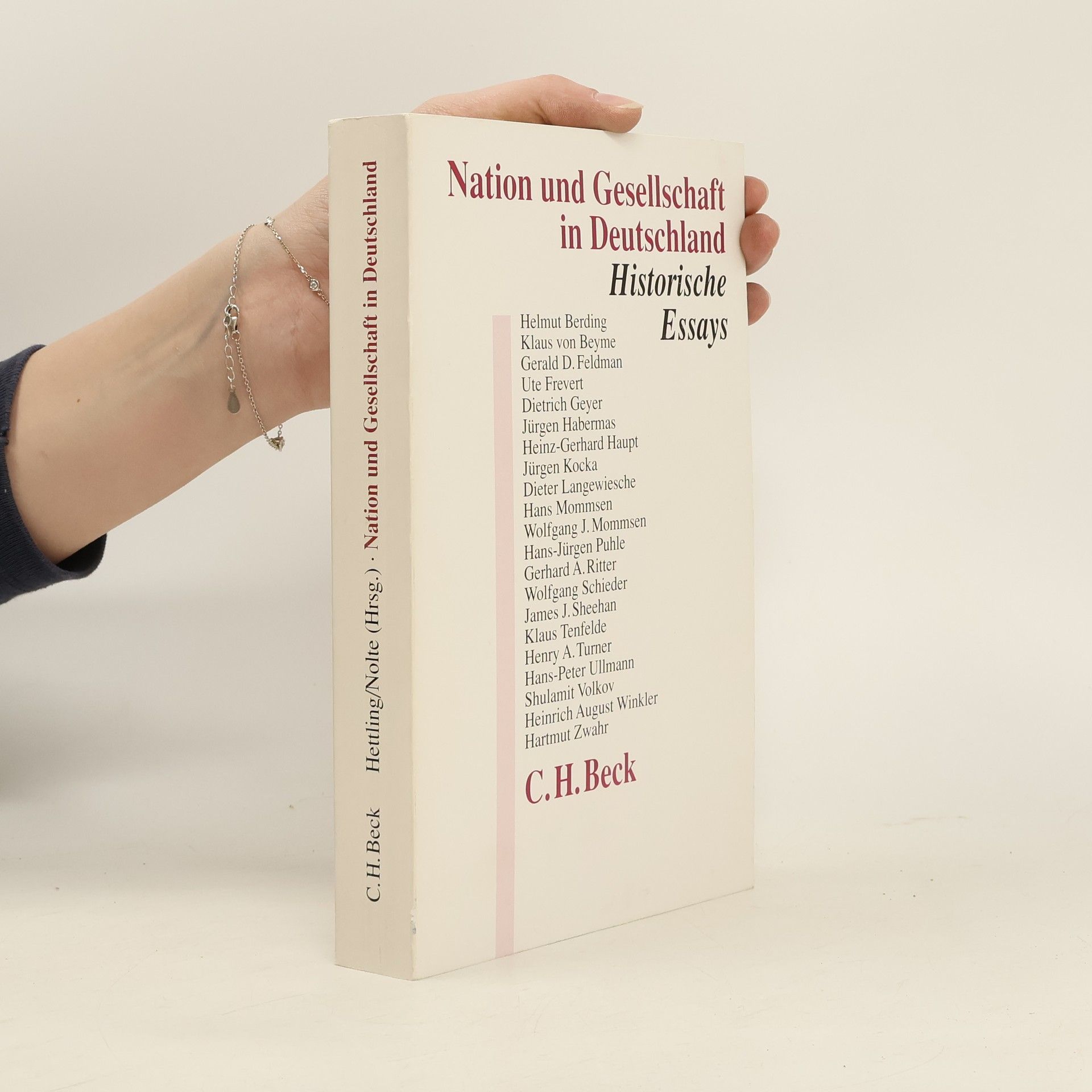

Für den „Kleinen Brockhaus” von 1949 war das Bürgertum in Westeuropa eine entscheidende Massenschicht für das öffentliche Leben. Doch blieb die Existenz eines Bürgertums in Deutschland nach 1945 mehr als eine Illusion? War es ein visionäres Projekt, in das alle Bürger strebten, ohne dass ein echtes Bürgertum je existierte? Abgesänge auf das Bürgertum sind oft verfrüht; die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, dass nach dem antibürgerlichen Nationalsozialismus eine Renaissance der bürgerlichen Ordnung folgte. Diese Ordnung blieb selbst in ihrer Ablehnung, wie im Jahr 1968, relevant. Der Sammelband untersucht die fortdauernden Elemente von Bürgerlichkeit in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Durch autobiographische Interpretationen sowie historische und soziologische Analysen zeigen die Autoren, welche Aspekte des politischen Modells der bürgerlichen Gesellschaft überdauerten und die Geschichte der Bundesrepublik prägten. Der Band greift auch aktuelle Diskussionen zur Bürger- oder Zivilgesellschaft auf. Der Ruf nach der Wiederbelebung bürgerlicher Werte in Krisenzeiten bleibt bloße Rhetorik, solange die Bedingungen ihrer früheren Existenz nicht hinterfragt werden. Die Analysen zu bürgerlichen Lebensstilen, deren Kontinuitäten und Veränderungen, bieten nicht nur Einblicke in die Geschichte der Bundesrepublik und der DDR, sondern beleuchten auch historische Perspektiven auf Begriffe wie Bürgergesellschaft und Neoliberalismus neu.