In diesem Buch analysieren siebzehn Autorinnen und Autoren die Symphonien Gustav Mahlers und seine musikalische Welt. Jede Symphonie wird in einem eigenen Kapitel behandelt, das Porträts, Werkbeschreibungen und Essays umfasst. Themen wie Volksmusik, Mahlers Beziehungen und seine Rolle im Wiener Geistesleben werden ebenfalls beleuchtet.
Renate Ulm Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)


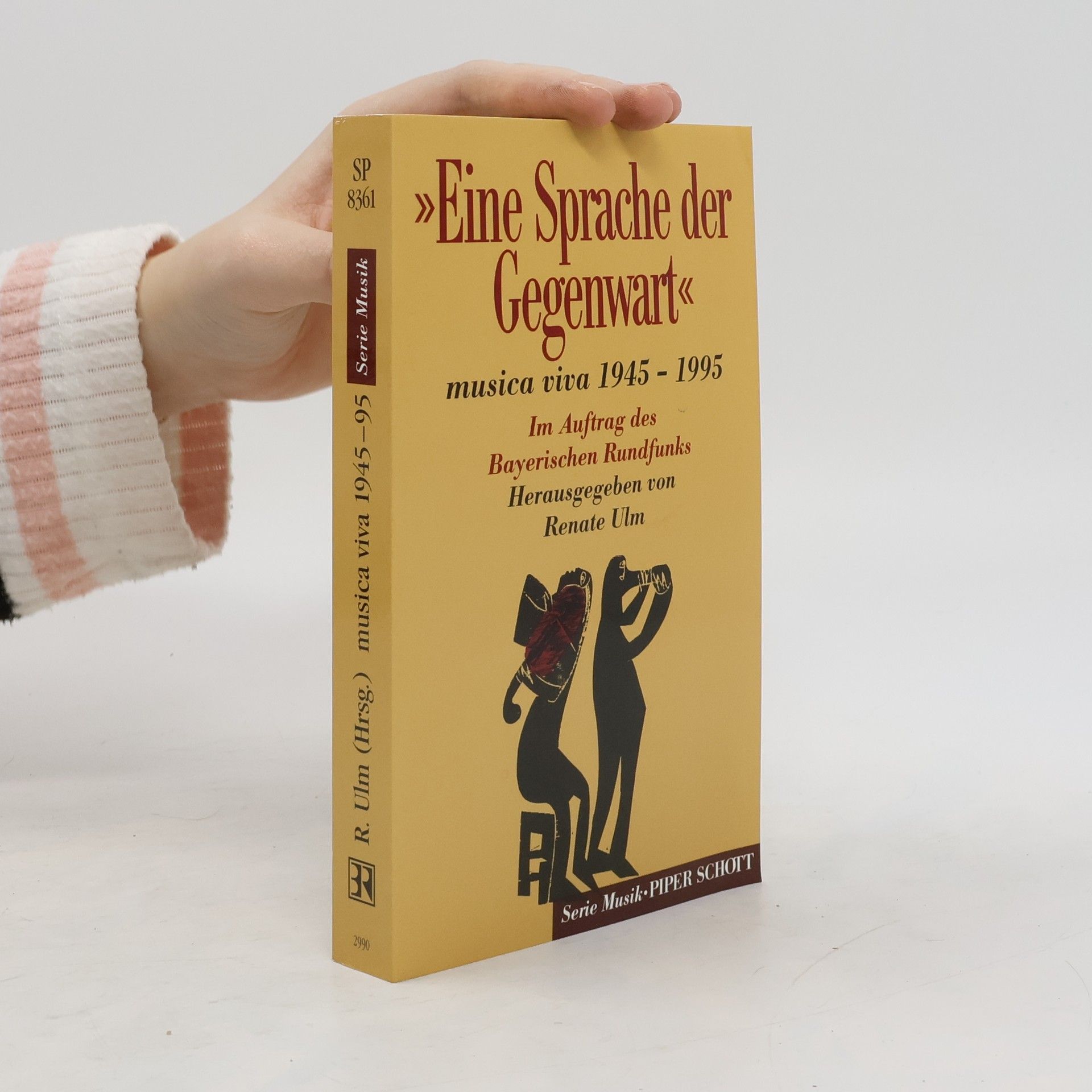

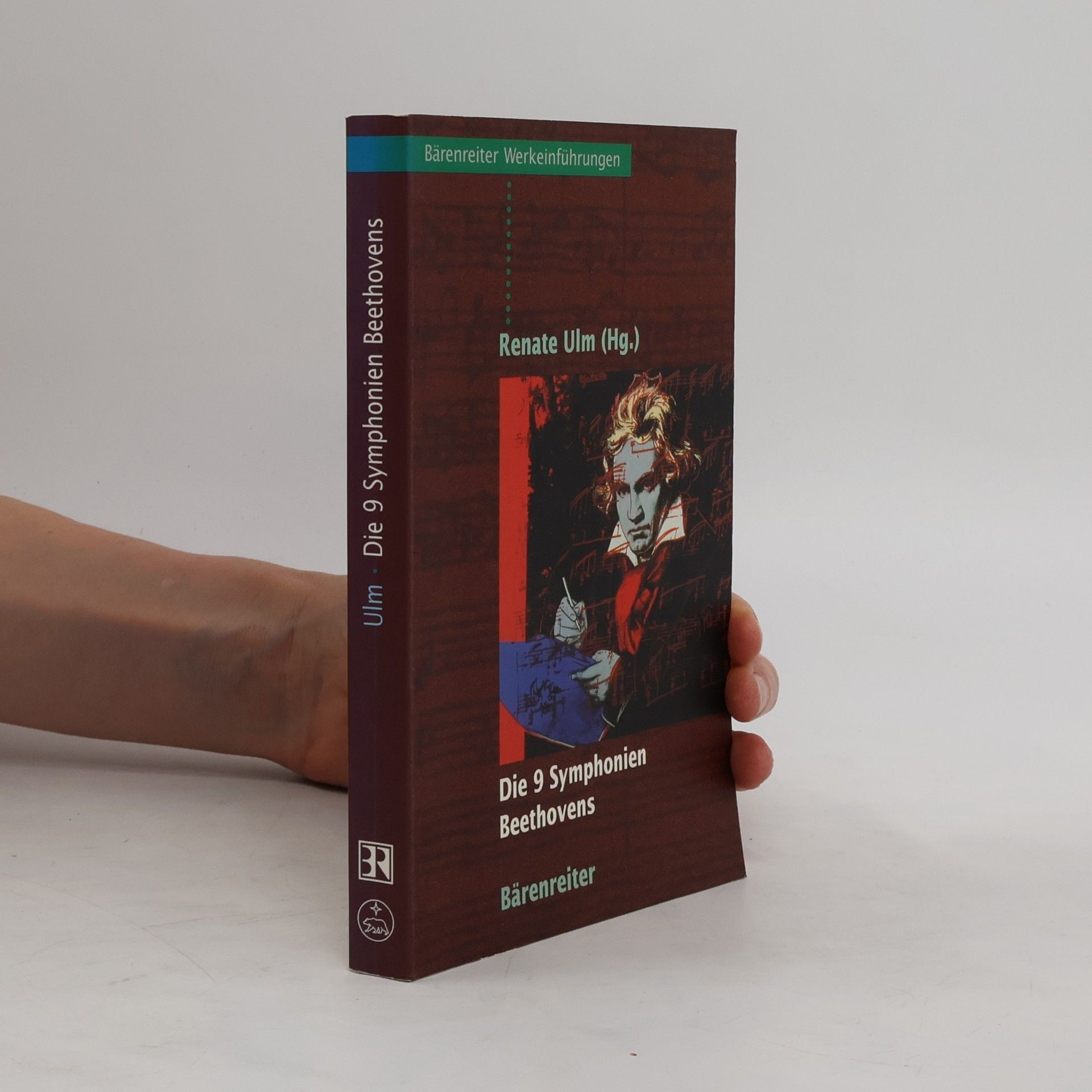
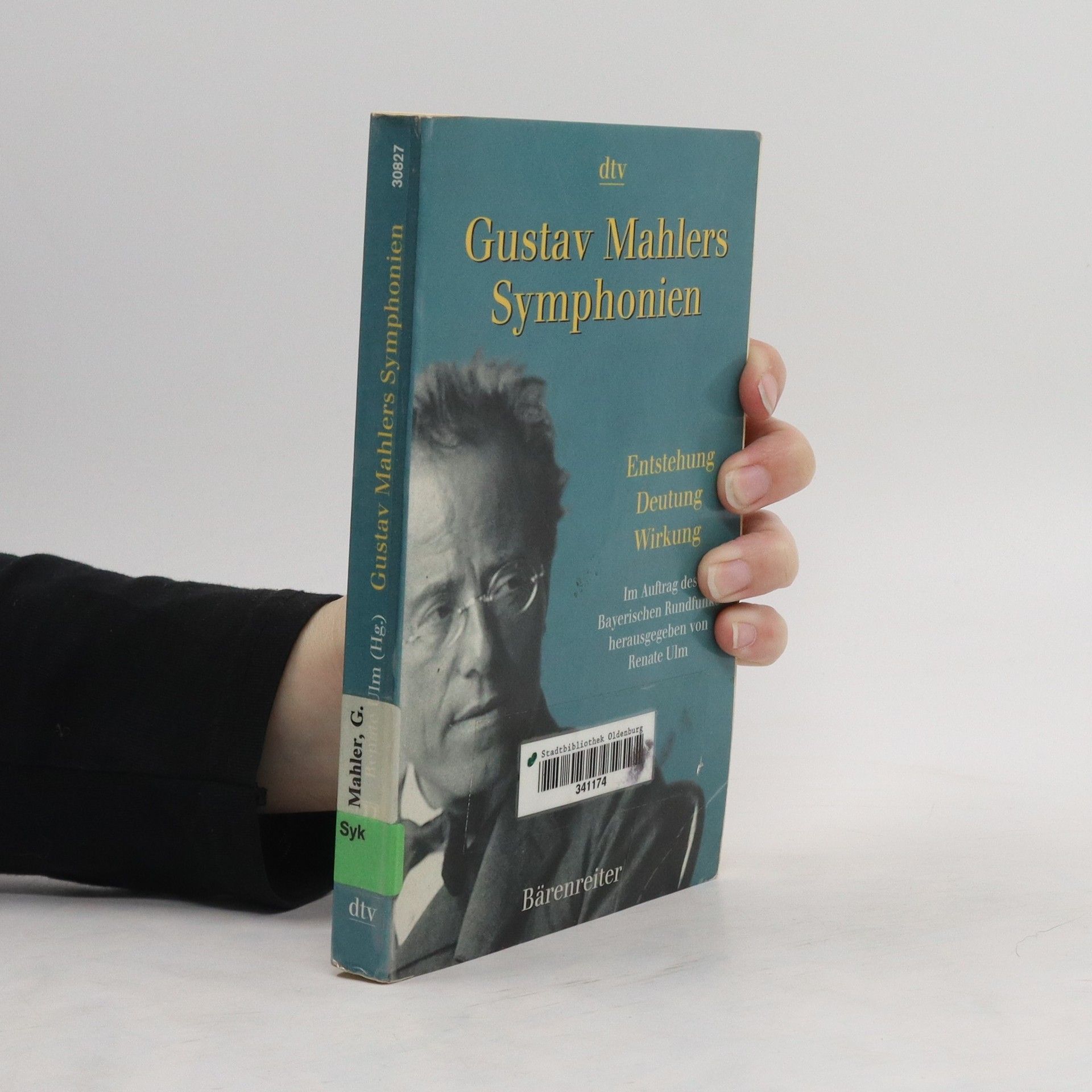
Eine Gesamtschau des „symponischen Prinzips Beethoven“: alle neun Symphonien, ihre Entstehung, Deutung und Wirkung in anschaulichen Einzelbeiträgen namhafter Musikwissenschaftler – für Konzertbesucher, Beethoven-Fans und Musikfreunde. Beethovens Symphonien kann man nicht „unverändert in der Seele, ohne Ergriffenheit und Aufschwung, ohne Schrecken und Scham oder Trauer, ohne Weh oder Freudenschauer” anhören – so umschrieb Hermann Hesse, was heute unverändert gilt: Beethovens neun Symphonien, uraufgeführt zwischen 1800 und 1824, faszinieren Hörer und Konzertbesucher auch in unseren Tagen, so im Februar/März 1995 durch den großen Konzertzyklus des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Lorin Maazel. Aus diesem Anlass haben zwölf Autoren, u. a. so namhafte Musikwissenschaftler wie Egon Voss, Martin Geck, Peter Rummenhöller, jede einzelne der neun Symphonien durchleuchtet. Der Leser erfährt die Entstehungsgeschichte im biographisch-historischen Umfeld, wird in die Werkanalyse und die ästhetischen Aspekte eingeführt, er kann lesend miterleben, was hinter den Tönen und Klängen steckt. Jeder der Beiträge ist ergänzt durch Briefzitate Beethovens, Kritiken der Uraufführungen und zeitgenössische Bildnisse.
Herausgeberin Renate Ulm hat im Auftrag des Bayerischen Rundfunks 16 Autorinnen und Autoren gewonnen, die in Einzelbetrachtungen das symphonische Werk von Johannes Brahms (1833-1897) für uns erschliessen.Nach einem einleitenden Teil, mit Vorwort von Lorin Maazel, sind das:- Serenaden, Variationen, Ouvertüren;- Konzerte;- Symphonien.Dokumente zu jedem Werk – Briefzitate und Kritiken – sowie zeitgenössischeDarstellungen und Daguerreotypien ergänzen das musikalische Brahms-Bild.mit NotenbeispielenEs ist eine gemeinschaftliche Ausgabe von:Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv) mit ISBN-10: 342330569x (ISBN-13: 9783423305693) undBärenreiter, mit ISBN-10: 3761812647 (ISBN-13: 9783761812648). JM
Johannes Brahms, den Robert Schumann als den „Messias der neuen Tonkunst“ pries, schuf unvergessliche symphonische Meisterwerke: neben den vier Symphonien vor allem die Akademische und die Tragische Festouvertüre, die Ungarischen Tänze, Konzerte, Serenaden und die Haydn-Variationen. Namhafte Autoren erschließen in allgemeinverständlichen Einzelbetrachtungen und Essays diese Werke und ihren biografisch-historischen Hintergrund und zeichnen ein eindringliches Bild der Persönlichkeit des Komponisten. Dokumente zu jedem Werk sowie zeitgenössische Darstellungen ergänzen das musikalische Brahms-Bild. Die Autoren: Lorin Maazel, Kaus Döge, Wolfgang Dömling, August Gerstmeier, Peter Gülke, Rüdiger Heinze, Peter Jost, Robert Pascall, Armin Raab, Nicole Restle, Bernhard Rzehulka, Doris Sennefelder, Wolfgang Stähr, Renate Ulm, Egon Voss
Die 9 Symphonien Beethovens
Entstehung, Deutung, Wirkung : mit 10 Beethoven-Porträts
- 279 Seiten
- 10 Lesestunden
Eine Gesamtschau des "symphonischen Prinzips Beethoven": alle neun Symphonien, ihre Entstehung, Deutung und Wirkung in anschaulichen Einzelbeiträgen namhafter Musikwissenschaftler - für Konzertbesucher, Beethoven-Fans und Musikfreunde.