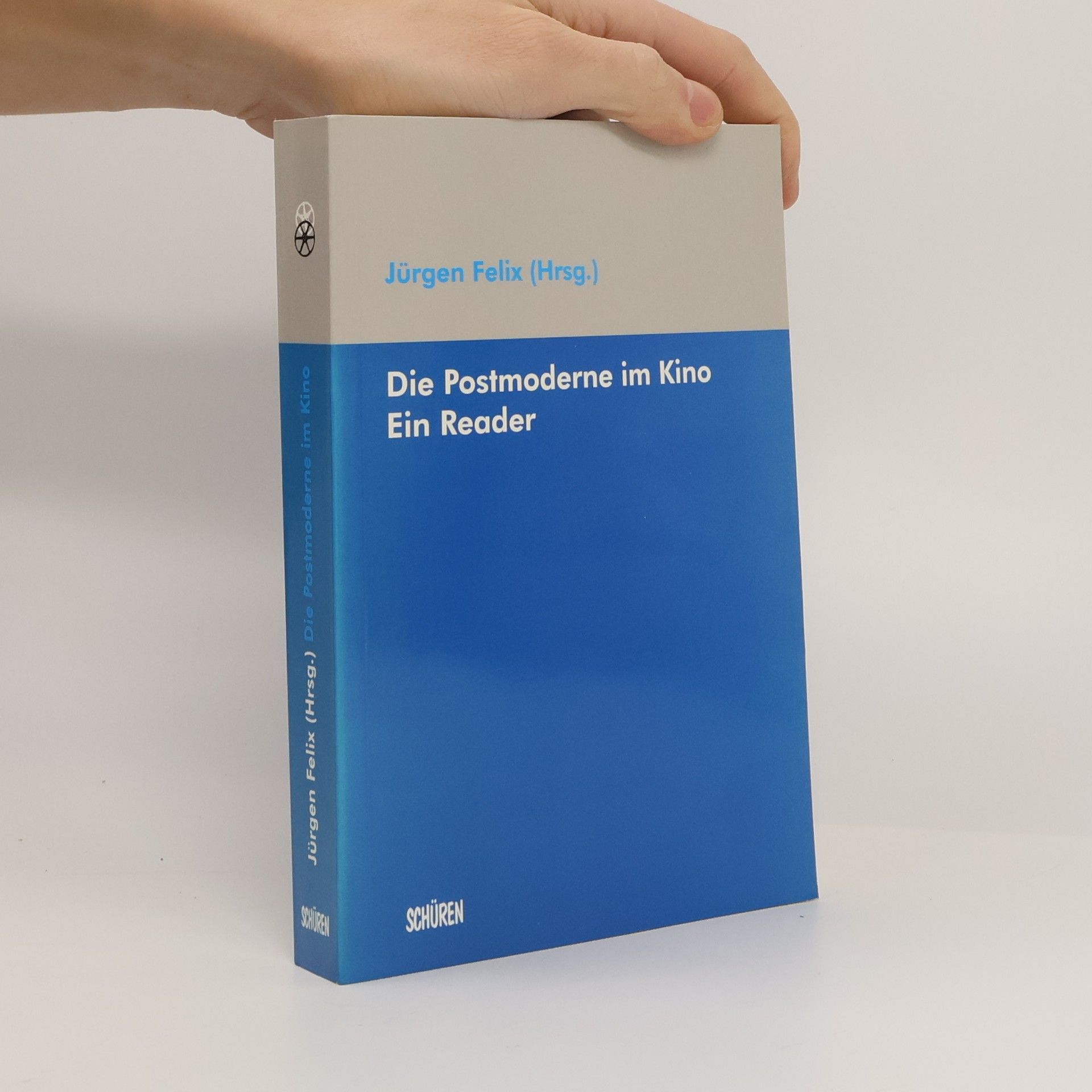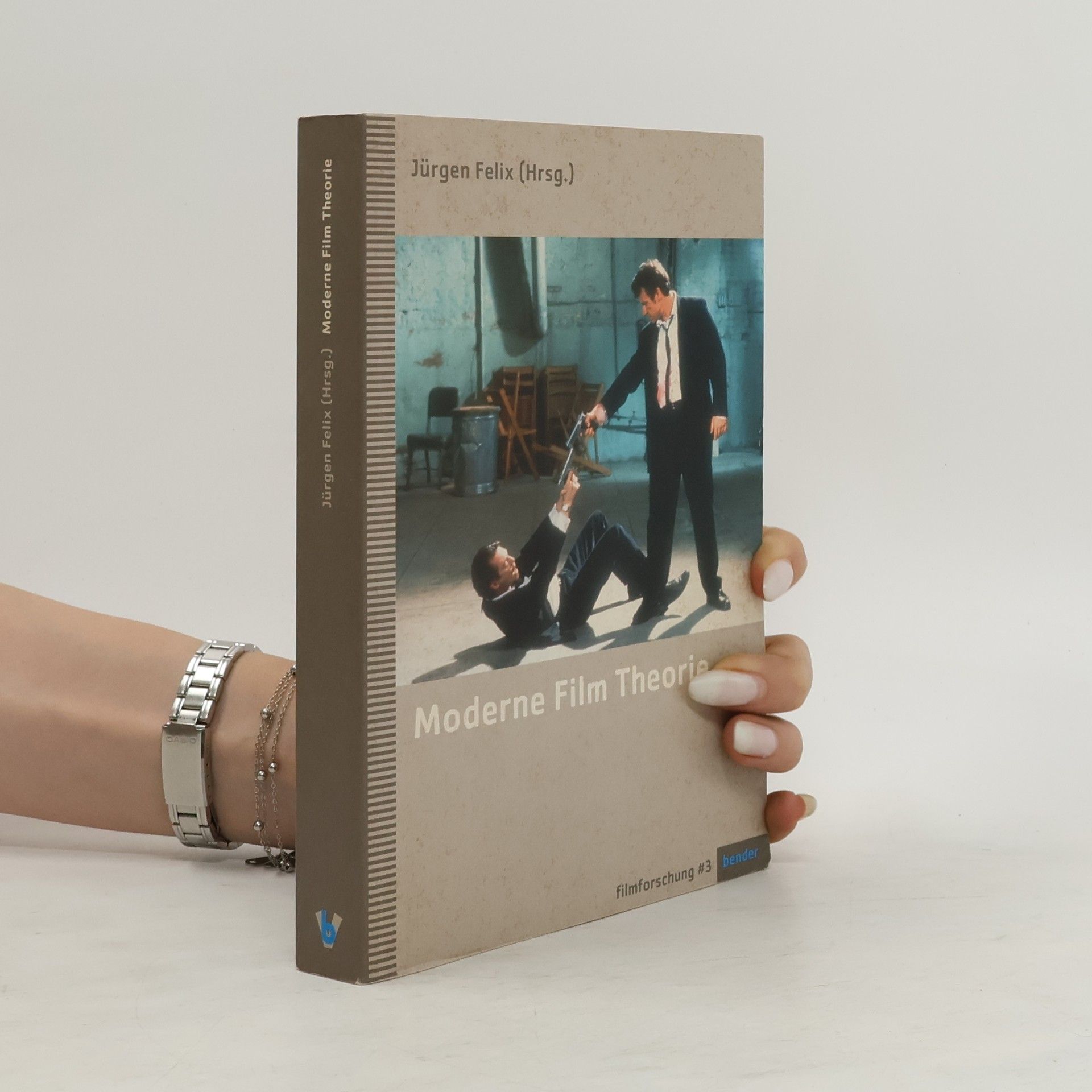Die Postmoderne im Kino
- 320 Seiten
- 12 Lesestunden
Reader mit Beiträgen von: Jean Baudrillard, Giuliana Bruno, Barbara Creed, Umberto Eco, Thomas Elsaesser, Jürgen Felix, Reinhold Görling, Norbert Grob, Fredric Jameson, Peter W. Jansen, E. Ann Kaplan, Andreas Kilb, Marsha Kinder, Klaus Kreimeier, Peter Krieg, Petra Maria Meyer, Reinhard Middel, Isabella Reicher, Drehli Robnik, Rainer Rother, Georg Seeßlen, Steven Shaviro