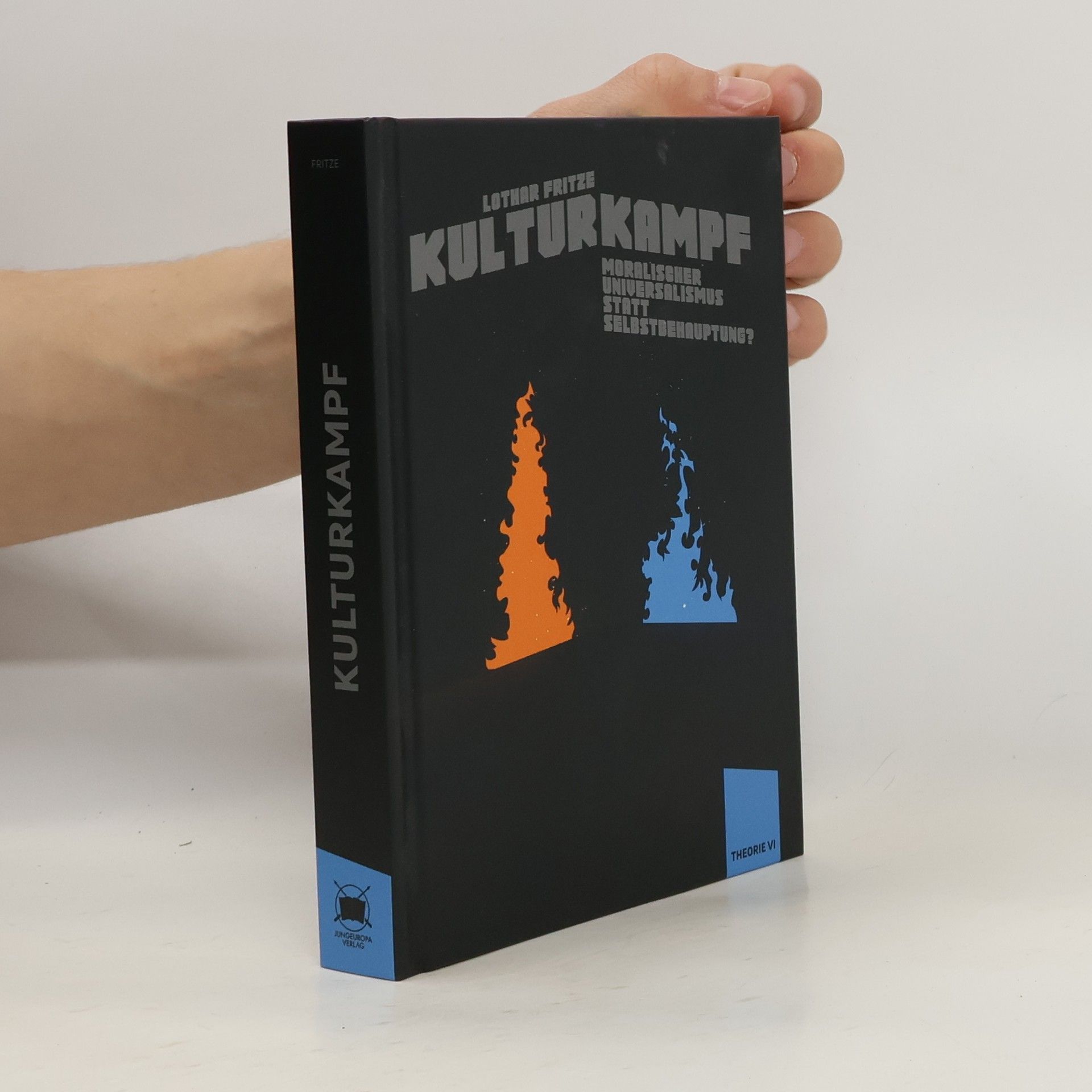Die Tötung Unschuldiger
- 263 Seiten
- 10 Lesestunden
Gilt das Verbot der Tötung Unschuldiger absolut oder darf selbst diese fundamentale Moralnorm unter Ausnahmebedingungen verletzt werden? Wir leben in einer Welt voller Gefahren. Das Leben von Menschen wird bedroht durch verbrecherische Diktaturen, terroristische Anschläge, technische Havarien und Katastrophen verschiedener Art. Dürfen solche Gefahren notfalls auch dann bekämpft werden, wenn dabei Unschuldige getötet werden oder ihr Tod in Kauf genommen werden muss? Das Buch gibt eine moralphilosophische Antwort auf diese politisch, ethisch und rechtlich umstrittene Frage. Lothar Fritze analysiert das Rechtsdogma der Nichtabwägungsfähigkeit menschlichen Lebens und fragt, wie sich das Verbot der Tötung Unschuldiger mit der verbreiteten moralischen Intuition vereinbaren lässt, wonach in Extremfällen durchaus einige wenige unschuldige Menschen geopfert werden dürfen, um sehr viele andere Unschuldige zu retten.