Helmut Stubbe da Luz Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
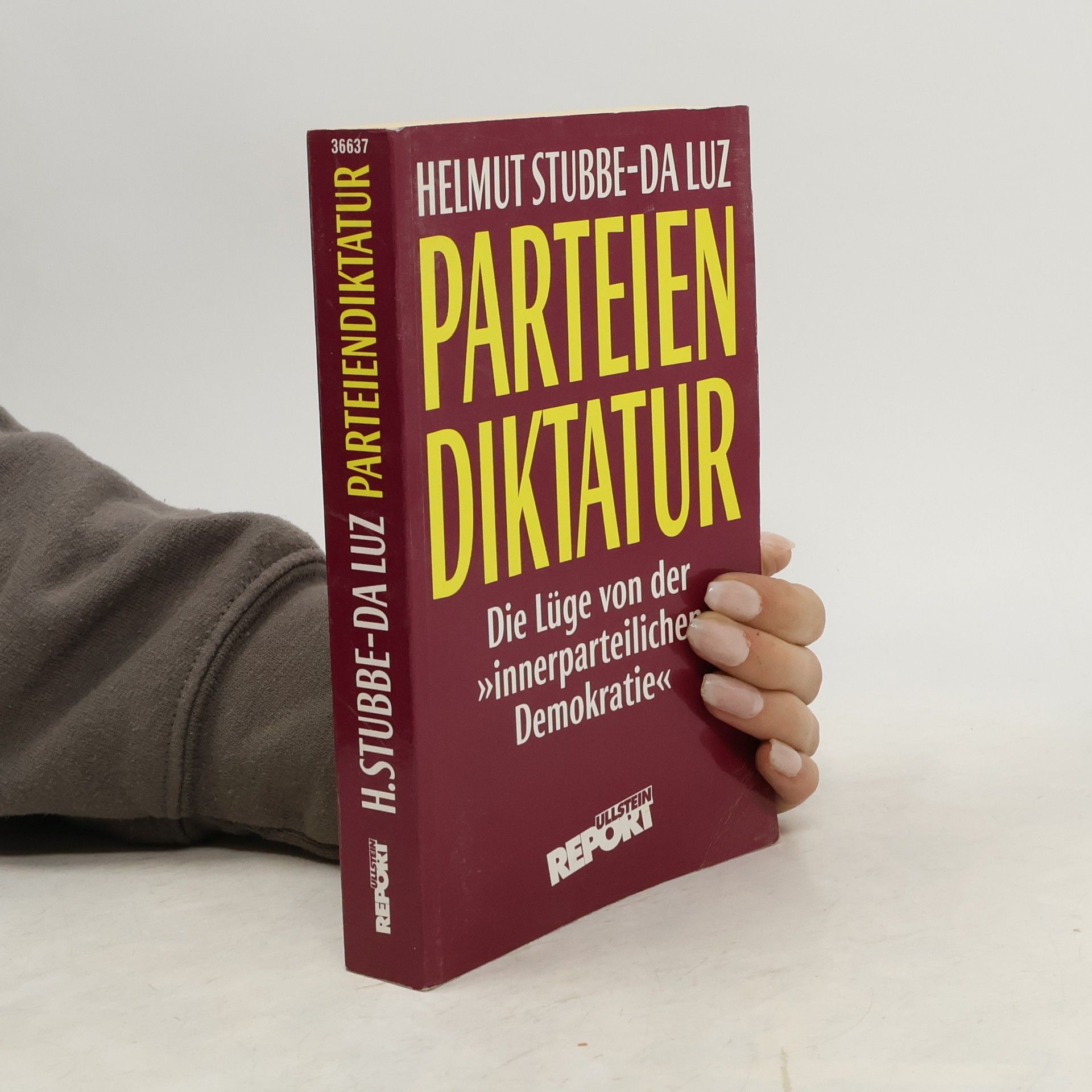


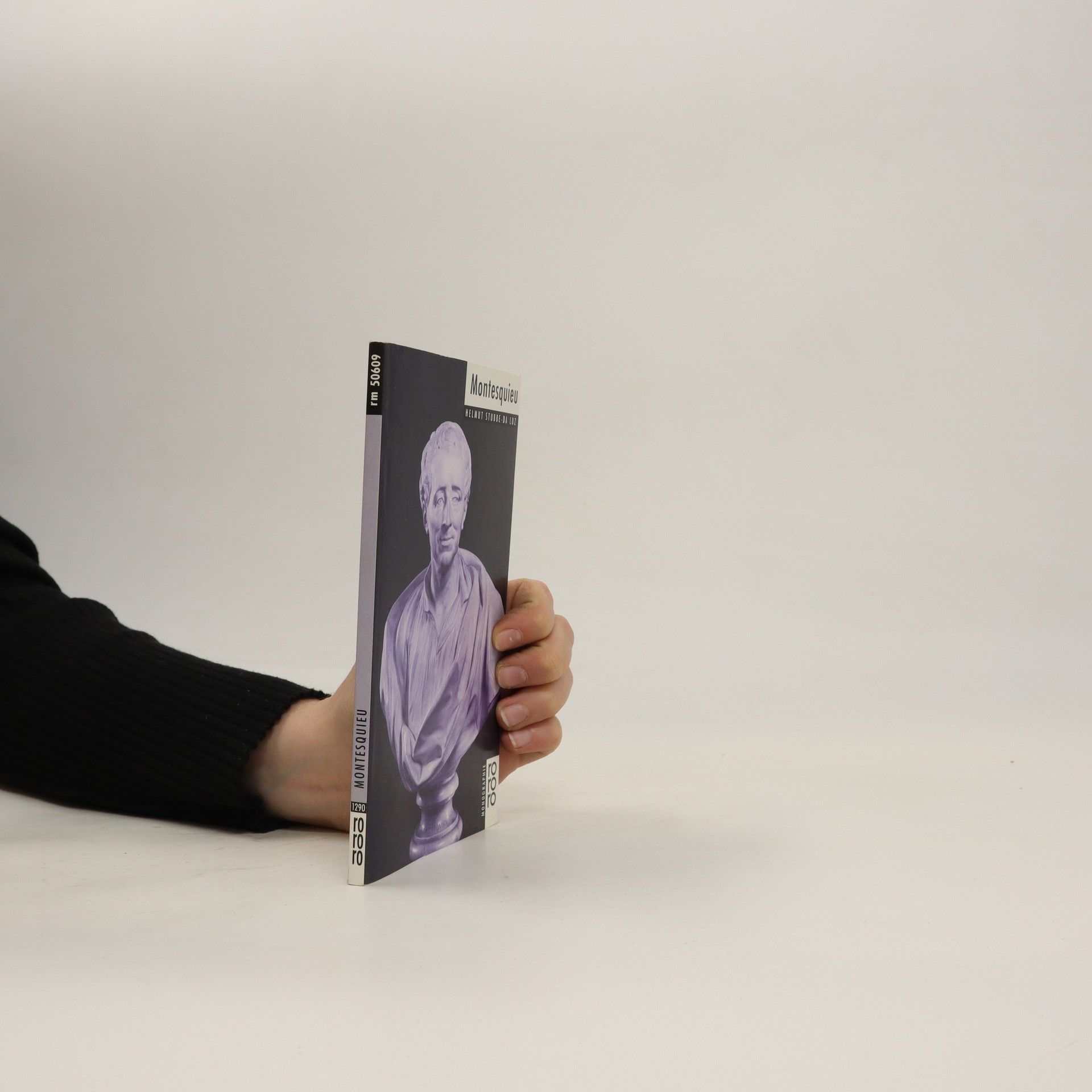
¿Extreme Situationen, schnelle Entscheidungen¿
Helmut Schmidt gegen Sturmflut und RAF-Terror
Hochwasser-Katastrophe 1962: Verbot das Grundgesetz die Rettung und Versorgung von Sturmflut-Opfern durch die Bundeswehr? Hat Helmut Schmidt, der Hamburger Polizeisenator, sich darüber hinweggesetzt, beherzt, in einem „übergesetzlichen Notstand“? – RAF-Terror 1977: War die Bonner Verfassung erneut keine Orientierungshilfe, als zu entscheiden war, ob der entführte Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer und die 91 Insassen eines gekidnappten Lufthansa-Jets gerettet werden sollten – zum Preis der Freilassung inhaftierter Terroristen? Musste Schmidt, mittlerweile Bundeskanzler, erneut zurückgreifen auf „das schmerzhaft im Gewissen geprüfte Fazit“ seiner politischen Lebenserfahrung und seiner moralischen Einsicht? War er unausweichlich schuldhaft verstrickt – wie in einem antiken Drama? Zu Beginn der Corona-Krise 2020 ist mehrfach bedauert worden, dass Deutschland nicht mehr von einer Führungspersönlichkeit profitiere, wie Helmut Schmidt eine war. Dieses Buch stellt Legenden auf den Prüfstand – ganz im Sinne Helmut Schmidts: Hielt er doch viel von dem Philosophen Karl Popper und von „kritischer Vernunft“.
Montesquieu, dessen unerschöpfliches Hauptwerk «Vom Geist der Gesetze» sich auf dem päpstlichen Index verbotener Bücher wiederfand, gilt heute als «Vater» der Gewaltenteilung. Dem absolutistischen Regime seiner Zeit stellte er in philosophischer Gelassenheit und Kunstfertigkeit die Prinzipien der Balance und der Relativität, des Pluralismus und der Offenheit, der Verhältnismäßigkeit und des Willkürverbots entgegen. Ohne die Kenntnis seines Werks lässt sich auch in unserer Zeit keine Diskussion um politische Grundsätze führen.