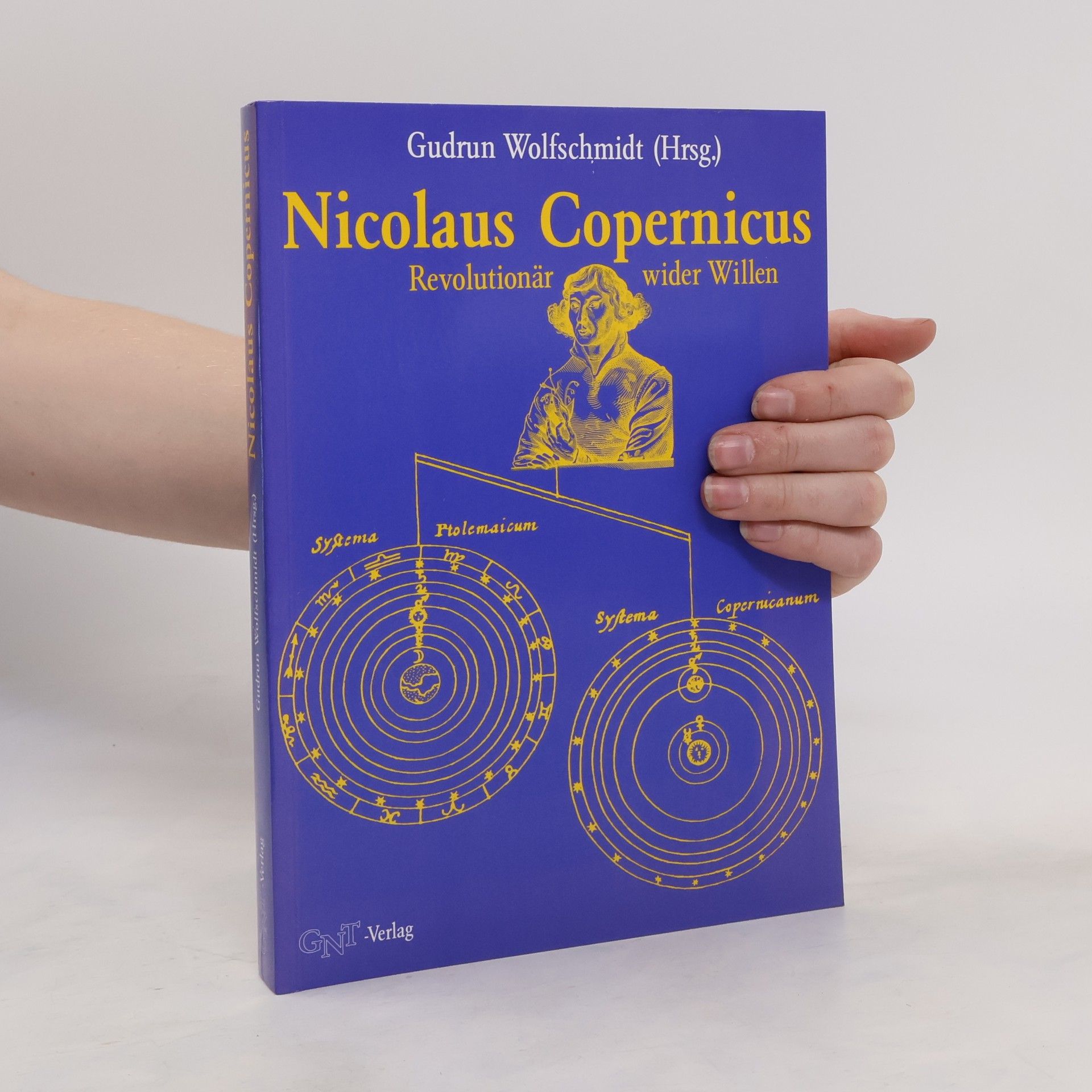Wandlungen in Raum und Zeit: Himmel -- Heimat -- Weltverständnis. Transformations in Space and Time: Heaven -- Home -- Understanding of the World.
Proceedings der Tagung der Gesellschaft für Archäoastronomie in Recklinghausen 2022. Nuncius Hamburgensis -- Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften; Band 58.
- 388 Seiten
- 14 Lesestunden
In 14 Kapiteln erforscht das Buch die Archäo- und Kulturastronomie und bietet eine umfassende Einführung in die kulturellen Vorstellungen von einem Welt-Organismus und kosmischen Lebewesen. Es verbindet verschiedene kulturelle Perspektiven und thematische Ansätze, um die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Kosmos zu beleuchten. Die Vielfalt der behandelten Themen regt zum Nachdenken über die Beziehung zwischen Raum, Zeit und menschlicher Wahrnehmung an.