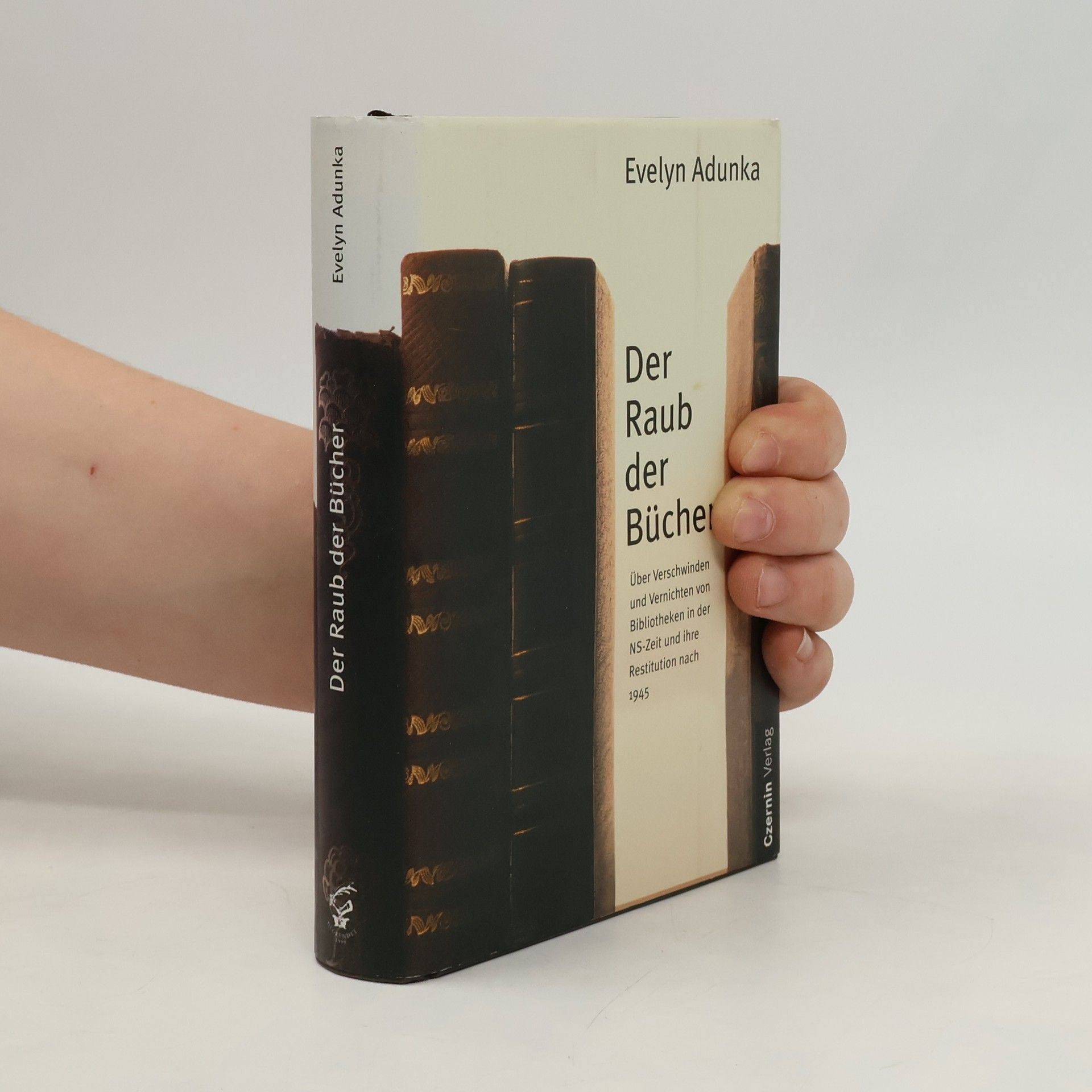Eine Zeitreise in die Vielfalt verlorenen jüdischen Lebens in Wien – jetzt in der überarbeiteten und ergänzten Neuauflage. Der große Tempel in der Hubergasse, drei Bethäuser und soziale Vereine zeugten von einem aktiven jüdischen Leben. Unter den hier lebenden Juden und Jüdinnen waren wohlhabende Unternehmer und Grundbesitzer, vor allem aber viele ArbeiterInnen, kleine Gewerbetreibende, TaglöhnerInnen und Hausierer. Ein Teil von ihnen war zum Christentum konvertiert, konfessionslos oder lebte in gemischt-konfessionellen Ehen, viele waren in der Arbeiterbewegung aktiv. Auf Basis von Archivquellen, zeitgenössischen Publikationen, Erinnerungen und Interviews beleuchtet das Buch das jüdische Leben in den beiden Bezirken vor dem März 1938, vor allem aber auch die Verfolgung, Beraubung, Flucht und Deportation während der NS-Zeit. In dem Buch werden die Lebensläufe prominenter BewohnerInnen, wie der Schriftsteller Ernst Waldinger und Frederic Morton (Fritz Mandelbaum), oder der Mitglieder der Industriellenfamilie Kuffner ebenso nachgezeichnet wie jene von wenig bekannten jüdischen OttakringerInnen und HernalserInnen.
Evelyn Adunka Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
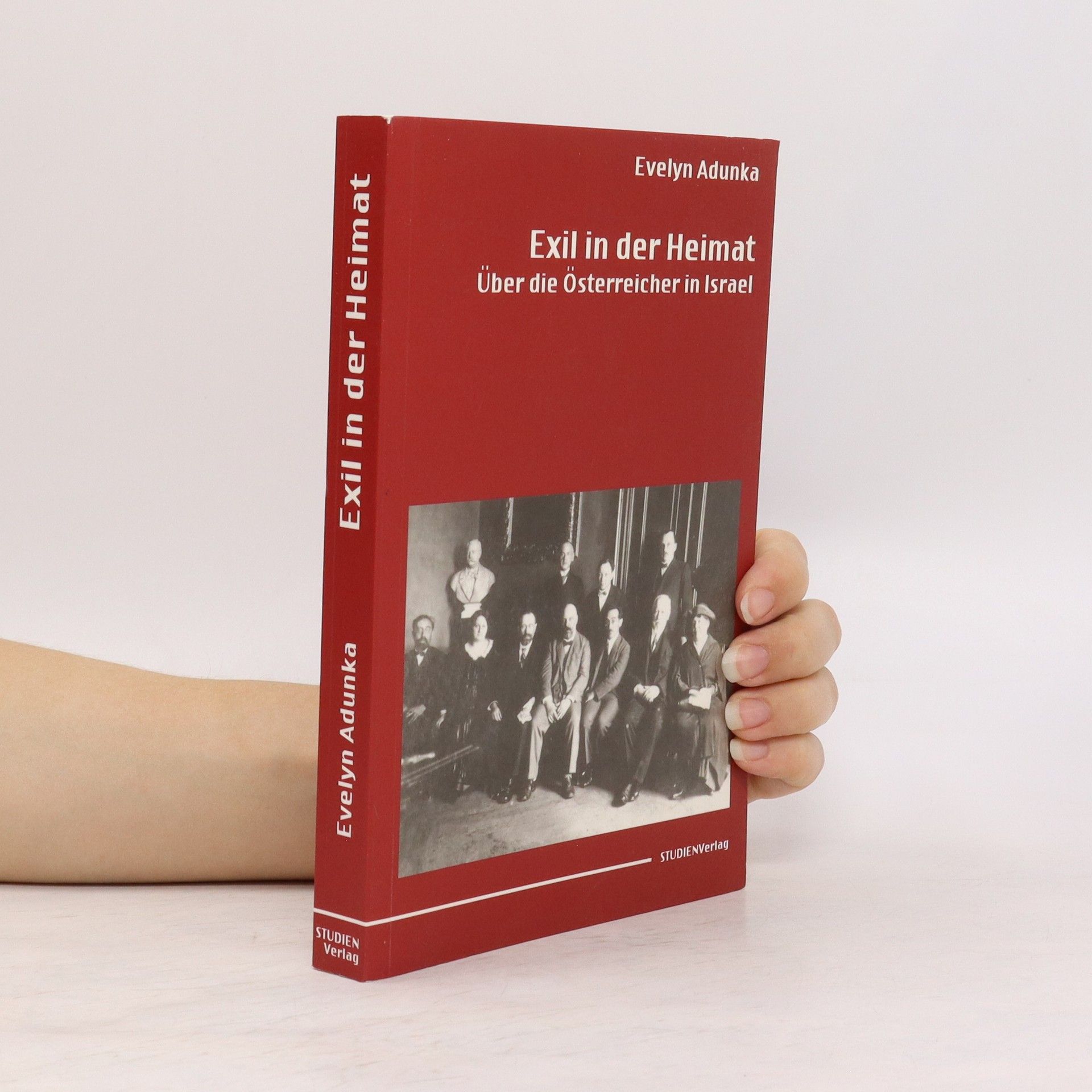



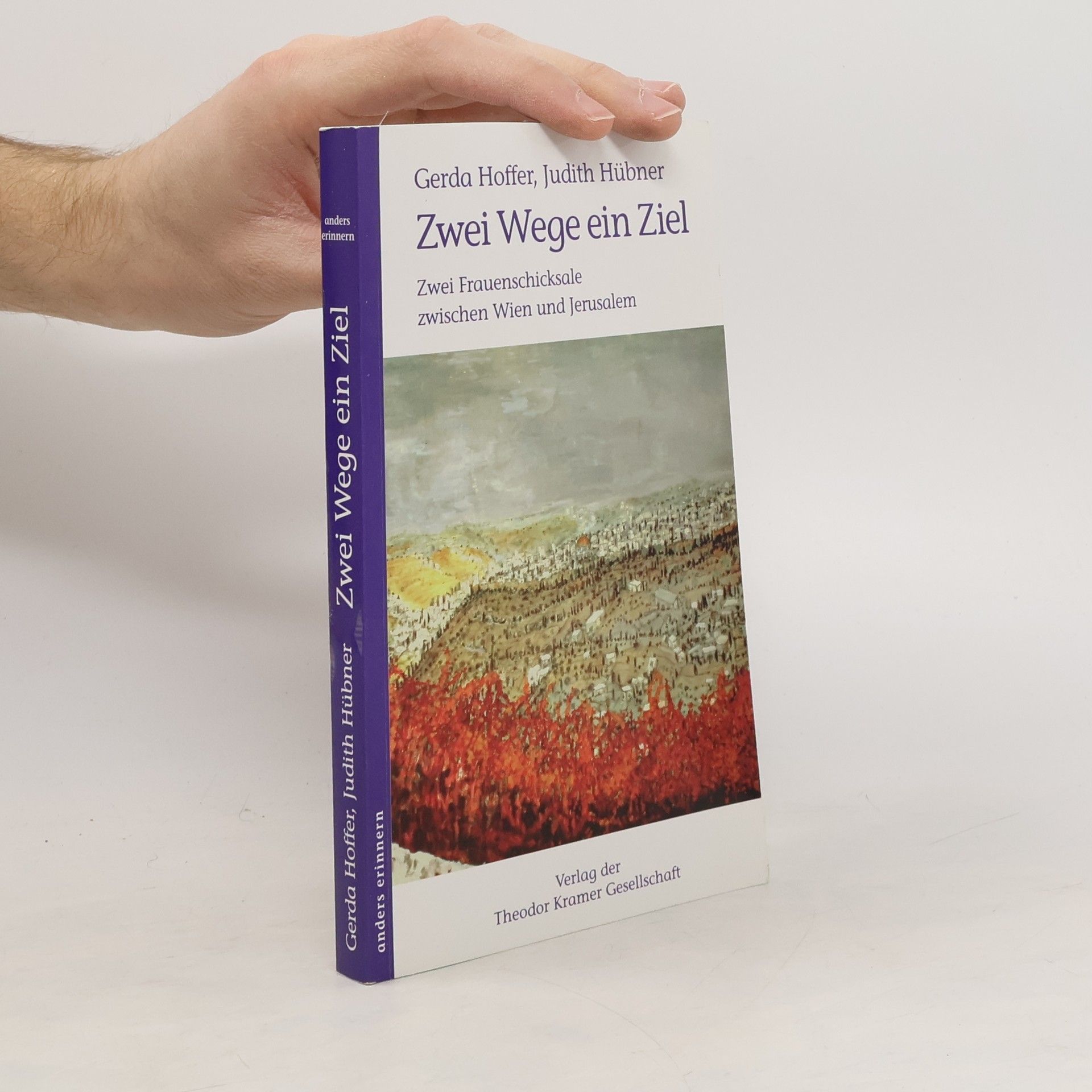
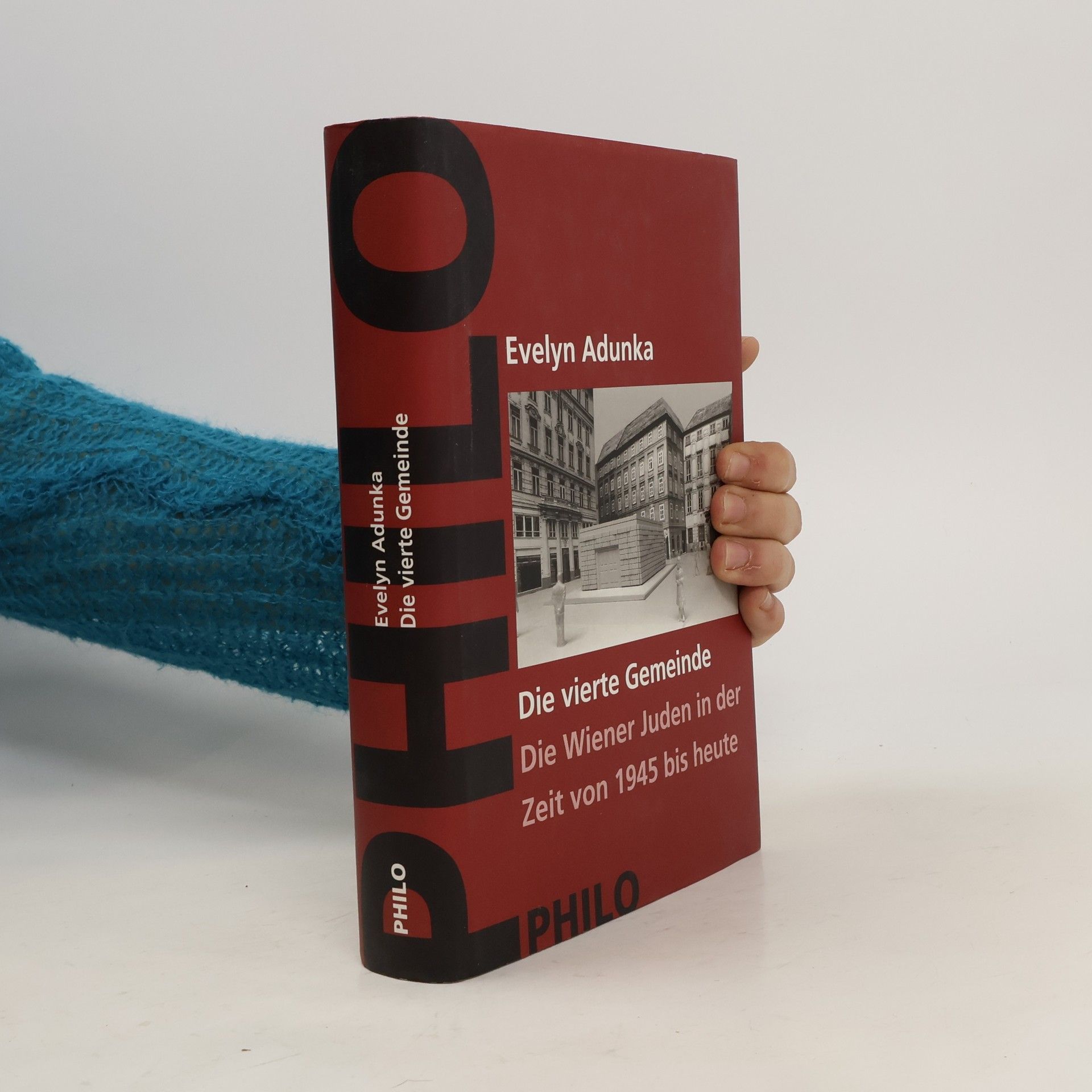
Vieler Sterne Geist
Moderne jiddische Lyrik - Eine Auswahl
In Nachdichtungen von Alfons Petzold und Marek Scherlag Gedichte von Chaim Nachmann Bialik, Gerson Braudo, Meier Chartiner, Dawid Einhorn, S. Frug, S. V. Imber, Jehoasch, Michael Kaplan, B. Lapin, Lijesin, Nistor, H. D. Nomberg, L. Perez, Abraham Reisen, Morris Rosenfeld, S. Schni, M. Wintschewski, M. Wirth
Jüdisches Leben in der Wiener Vorstadt - Ottakring und Hernals
- 389 Seiten
- 14 Lesestunden
Jüdische Spuren in der Wiener Vorstadt In den Bezirken Ottakring und Hernals, 1892 durch die Eingemeindung selbständiger Vororte entstanden, lebten 1910 2,6 bzw. 2 Prozent der Mitglieder der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde. Der große Tempel in der Hubergasse, drei Bethäuser und soziale Vereine zeugten von einem aktiven jüdischen Leben. Unter den hier lebenden Juden und Jüdinnen waren wohlhabende Unternehmer und Grundbesitzer, vor allem aber viele ArbeiterInnen, kleine Gewerbetreibende, TaglöhnerInnen und Hausierer. Ein Teil von ihnen war zum Christentum konvertiert, konfessionslos oder lebte in gemischt-konfessionellen Ehen, viele waren in der Arbeiterbewegung aktiv. Auf Basis von Archivquellen, zeitgenössischen Publikationen, Erinnerungen und Interviews beleuchtet das Buch das jüdische Leben in den beiden Bezirken vor dem März 1938, vor allem aber auch die Verfolgung, Beraubung, Flucht und Deportation während der NS-Zeit. Es werden die Lebensläufe prominenter Bewohner wie der Schriftsteller Ernst Waldinger und Frederic Morton (Fritz Mandelbaum) oder der Mitglieder der Industriellenfamilie Kuffner ebenso nachgezeichnet wie jene von wenig bekannten jüdischen OttakringerInnen und HernalserInnen.
Das Buch zweier Freundinnen, einer Schriftstellerin und einer Politikerin. Beide wurden 1921 in Wien geboren. Gerda wuchs in einem liberalen, linken Umfeld auf, Judith in einem jüdisch-orthodoxen. Beide mussten 1938 vor den Nazis flüchten. Ihre Erinnerungen berichten von zwei sehr verschiedenen Erfahrungen und einem gemeinsamen Ziel: Jerusalem.
Die Rezeption des Exils
Geschichte und Perspektiven der österreichischen Exilforschung
Während des Nationalsozialismus wurden in Österreich zahlreiche KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen vertrieben, deportiert und ermordet. An den Universitäten fehlt bis heute ein Lehrstuhl für Exil- und Holocaustforschung, und es gab keine umfassende Exilausstellung. Das Exil wird oft als abgeschlossenes Kapitel oder marginales Phänomen betrachtet, doch seine Rezeption ist entscheidend für die wissenschaftliche und kulturelle Geschichte Österreichs sowie für die Etablierung einer demokratischen Kultur nach der Shoah. Die 2002 gegründete „Österreichische Gesellschaft für Exilforschung“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Kultur-, Wissenschafts-, Frauen- und Alltagsgeschichte des österreichischen Exils systematisch zu erforschen und im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Der interdisziplinäre Sammelband dokumentiert die Vorträge des gleichnamigen Symposiums aus dem Jahr 2001 und enthält Beiträge von S. Bolbecher, C. Brinson, C. Cargnelli, W. Duchkowitsch, W. G. Fischer, C. Fleck, M. Gruber, P. Gruber, F. Hausjell, H. Haider-Pregler, J. Holzner, D. Ingrisch, K. Kaiser, V. Kaukoreit, I. Korotin, B. Lang, A. Lichtblau, H. Lunzer, K. Müller, B. Müller-Kampel, M. Malet, B. Mayr, W. Neugebauer, M. Omasta, G. Scheit, B. Schmeichel-Falkenberg, U. Seeber, O. Seifert, F. Stadler, T. Venus, A. A. Wallas, E. Weinzierl und C. Zwiauer.
Das Leben aus Österreich nach Israel ausgewanderter Juden beschreibt die Autorin Evelyn Adunka in diesem spannenden zeitgeschichtlichen Werk: Während sie in den einleitenden Kapiteln einen Überblick über die Situation deutschsprachiger Juden in Palästina/Israel gibt, skizziert sie im zweiten Teil die Lebensgeschichten von 42 österreichischen Einwanderern in Israel. Die meisten dieser Emigranten waren zum Zeitpunkt ihrer Flucht aus Österreich in den 30-er Jahren bereits älter und wurden mit Gewalt aus einem Lebensraum gerissen, in dem sie ihre Existenz aufgebaut hatten. Trotz ihrer lebenslangen zionistischen Überzeugungen und Aktivitäten gelang es ihnen zumeist nicht, sich in ihrer neuen alten Heimat einzuleben, die für sie in gewissem Sinn ein Exil blieb. Mit Beiträgen u. a. über: Z. F. Finkelstein, Isidor Schalit, Max Grunwald, Viktor Kellner und Leopold Plaschkes. Zur Autorin: Evelyn Adunka, geb. 1965 in Villach, arbeitet als Publizistin und Historikerin in Wien. Ihr Schwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit dem österreichischen Judentum.
Die vierte Gemeinde
- 568 Seiten
- 20 Lesestunden