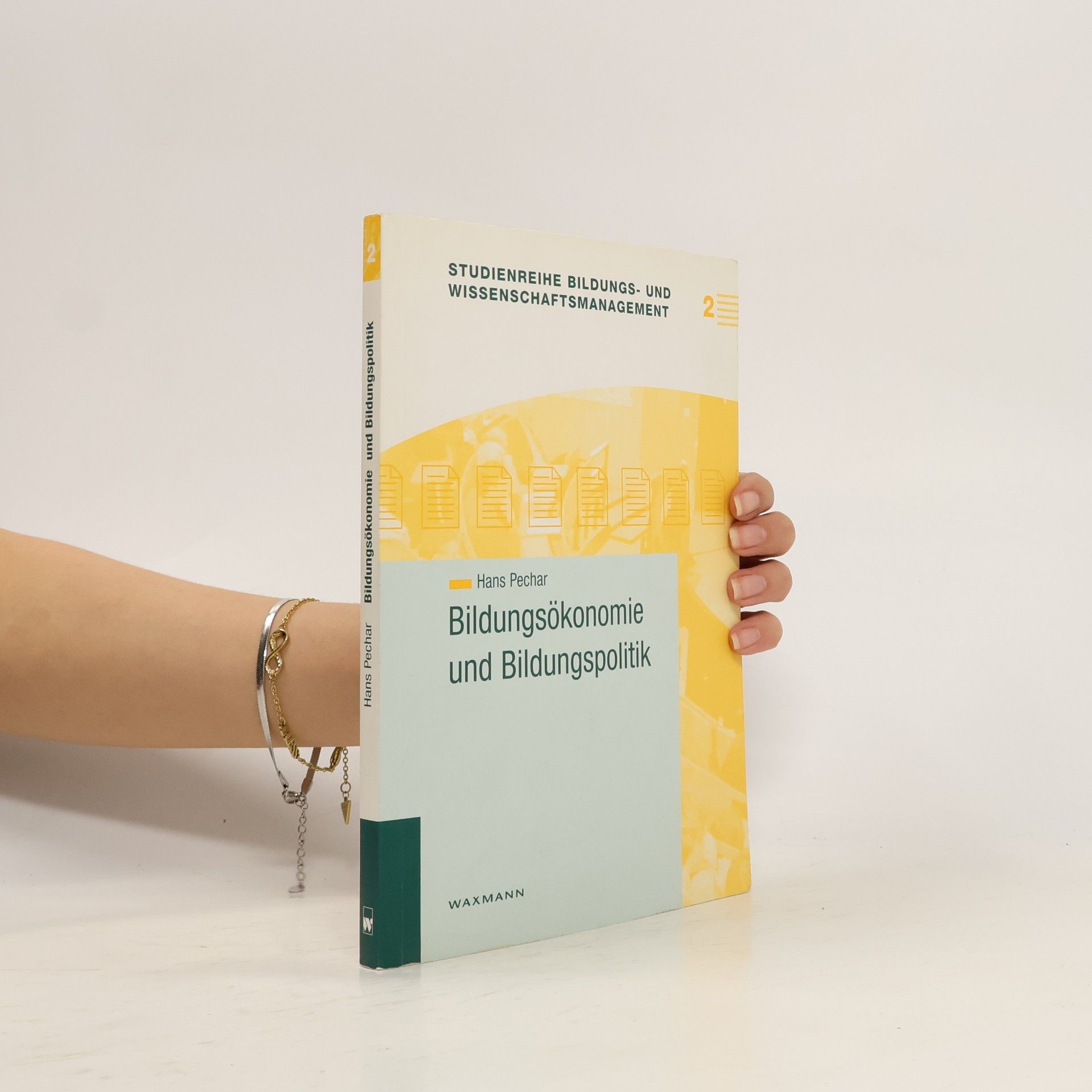Der Begriff „Bildung“ hat im deutschen Sprachraum einen besonderen Klang: Bildung gilt als Selbstzweck, nicht als Mittel für andere Zwecke. Dieses Buch thematisiert Bildung aber aus einer ökonomischen und politischen Perspektive. Es wird nach den Kosten von Schulen und Universitäten gefragt. Und diese Fragen werden in einen politischen Kontext gestellt, denn in allen Ländern befindet sich zumindest ein Teil des Bildungswesens in öffentlicher Verantwortung. Der Autor greift die ökonomischen Argumente auf, die in der bildungspolitischen Diskussion laufend an Gewicht gewonnen haben und zeigt zugleich die Grenzen einer „Ökonomisierung“ von Bildungseinrichtungen auf. Diese Analyse umfasst alle Stufen des Bildungssystems, von der vorschulischen Erziehung bis zur Weiterbildung. Der Autor greift dabei eine Reihe hochaktueller bildungspolitischer Problemstellungen auf. Unter anderem diskutiert er die Frage, ob Bildung als öffentliches oder privates Gut zu sehen und von wem sie zu finanzieren ist, und leistet damit einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion über die Einführung von Studiengebühren.
Hans Pechar Bücher