Der Band versammelt heitere und todernste, zynische und kulturkritische Texte über das Massenfaszinosum Sport. Aktiv beteiligt sind u. and. Roland Barthes, Bertolt Brecht, Umberto Eco, Erich Kästner, Günter Kunert, Reinhold Messner und Ror Wolf. DieseAnthologie ist kein Lesebuch der gesammelten Vorurteile; sie präsentiert vielmehr alle erdenklichen Spielarten der Sportapologie und Sportschelte. Dr. Volker Caysa, ehemaliger Hochleistungssportler, lehrt Philosophie an der Universität Leipzig.
Volker Caysa Bücher
24. Juni 1957 – 3. August 2017

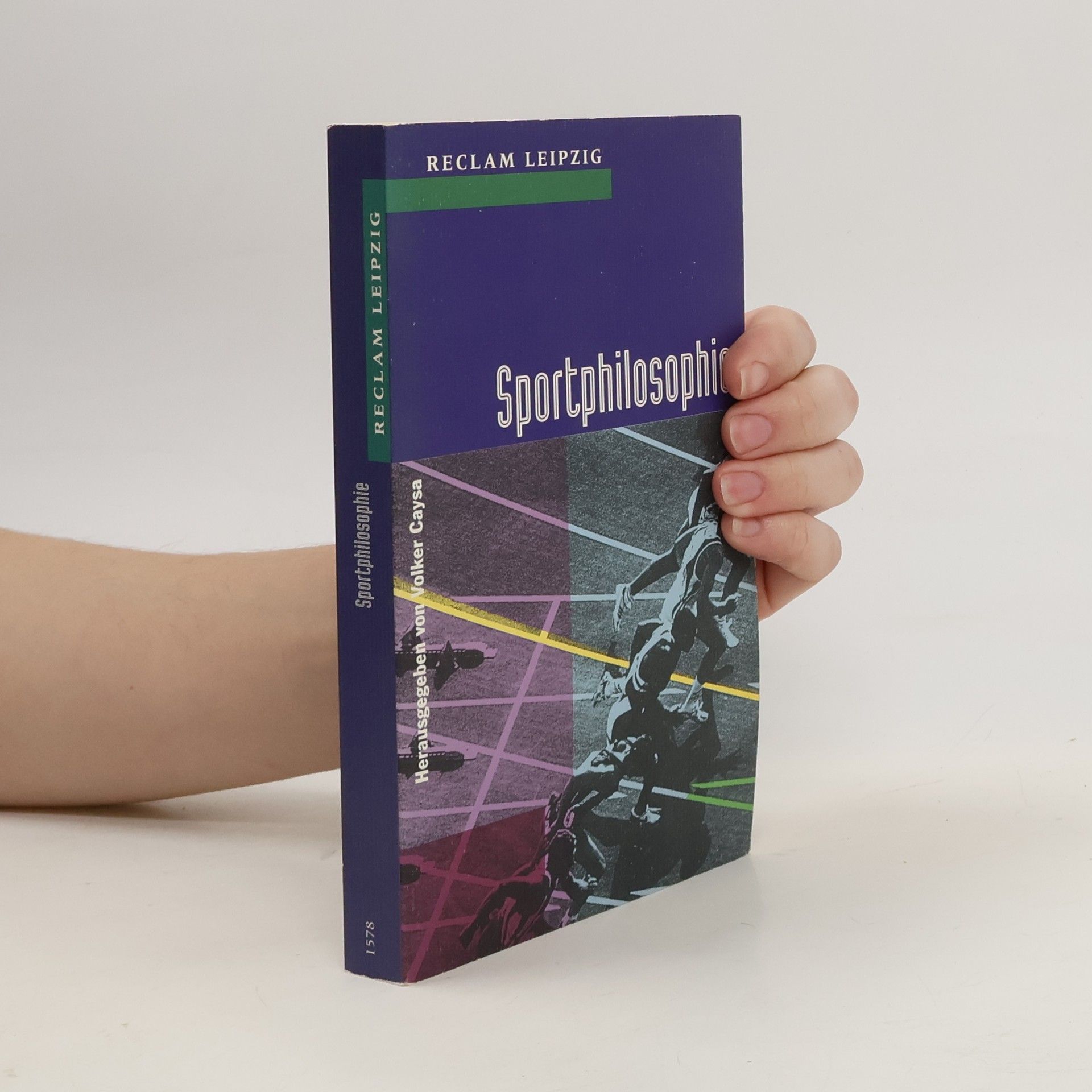
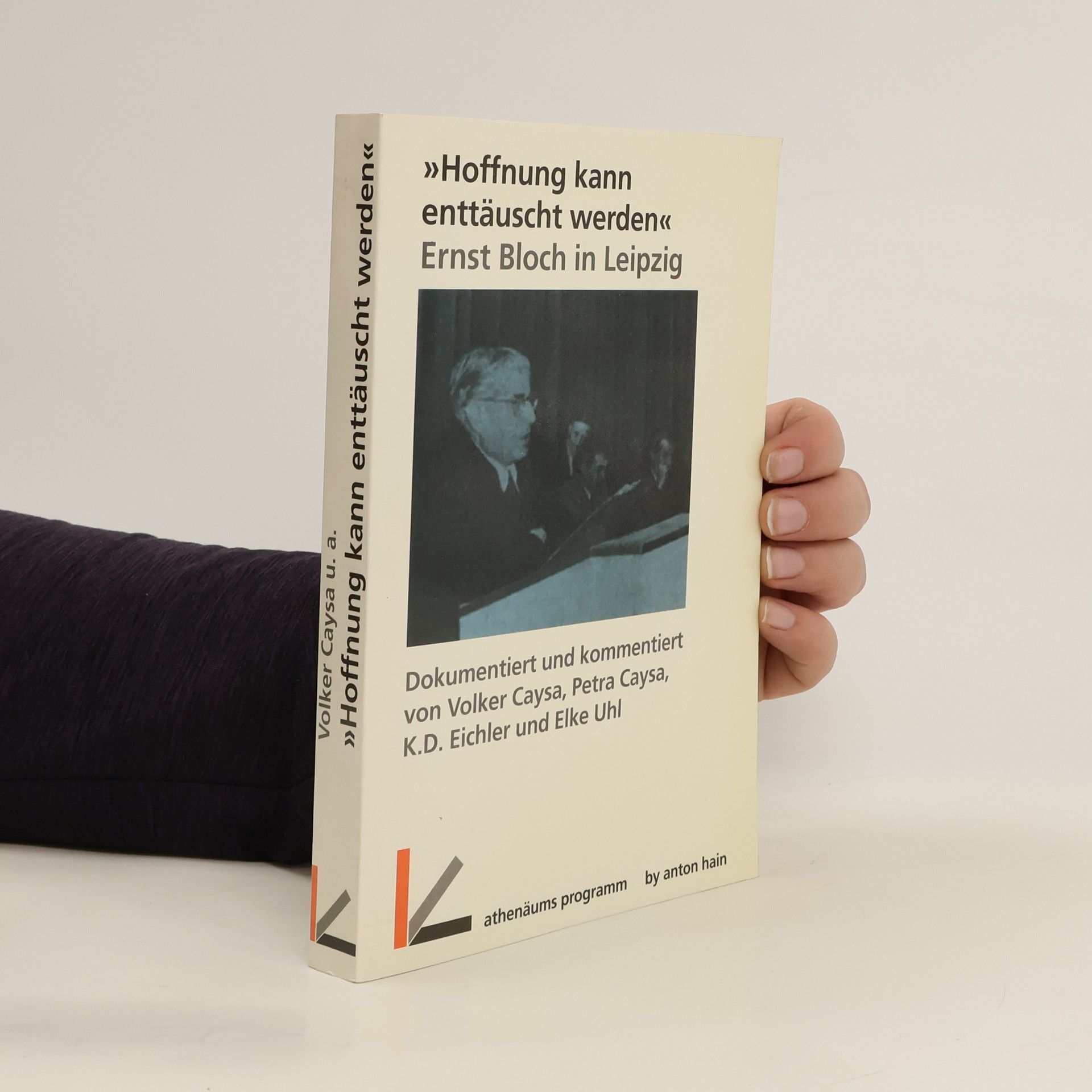
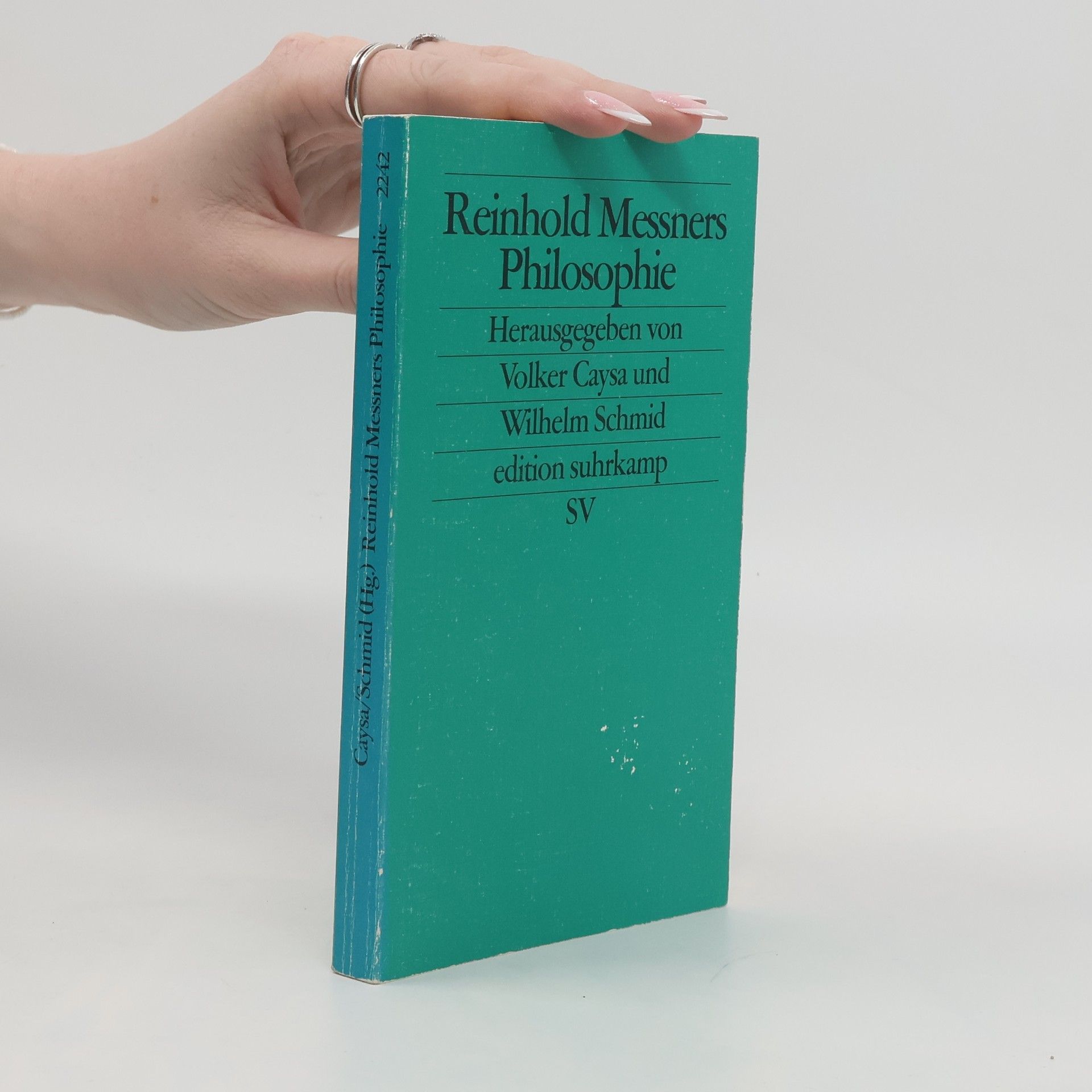

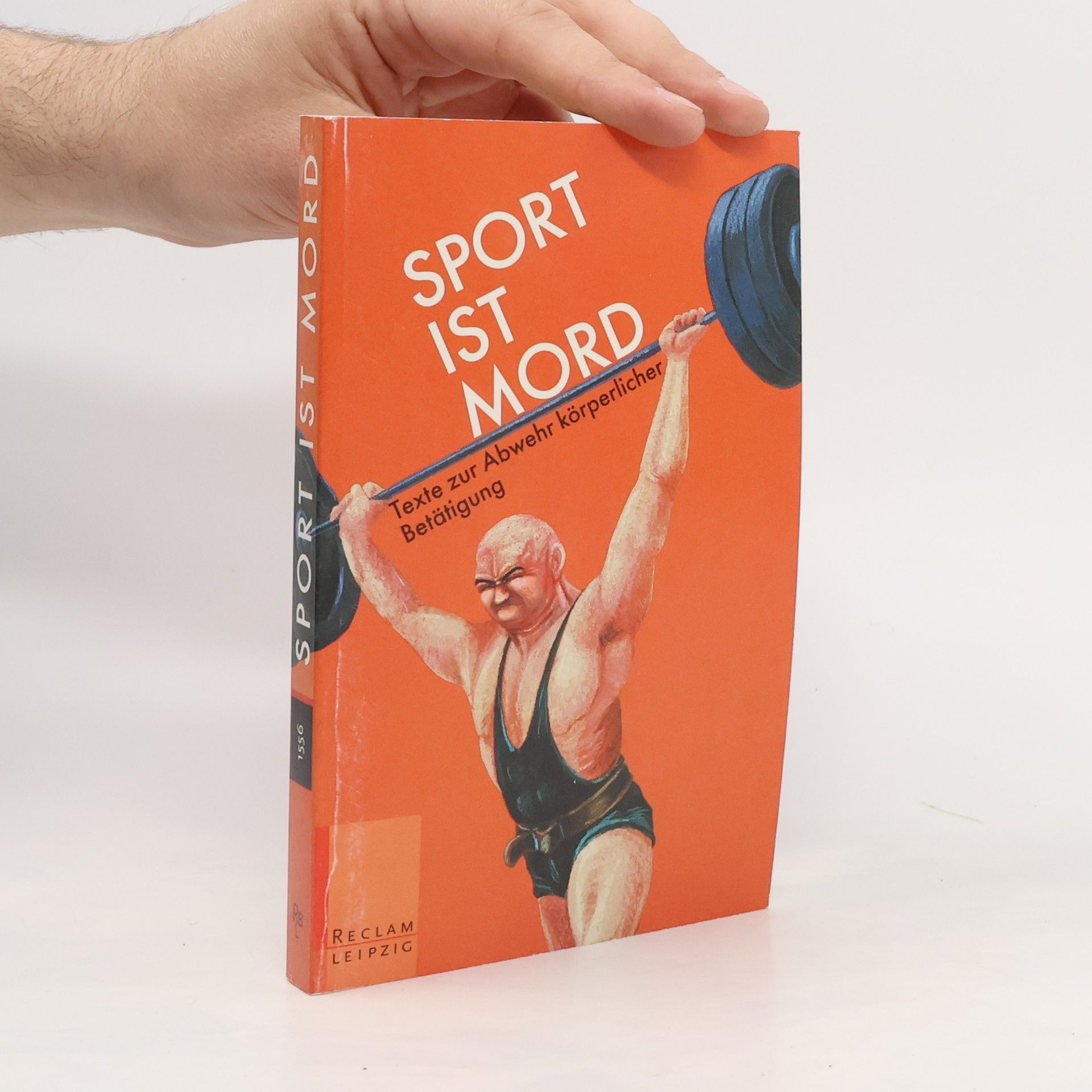
Edition Suhrkamp - 2242: Reinhold Messners Philosophie. Sinn machen in einer Welt ohne Sinn.
- 226 Seiten
- 8 Lesestunden
"Hoffnung kann enttäuscht werden"
- 339 Seiten
- 12 Lesestunden
Sportphilosophie
- 336 Seiten
- 12 Lesestunden
Ein Buch mit klarem Ziel: Bekämpfung, Eindämmung und Regulierung des modernen Schlankheits-, Fitneß- und Diätenwahns.