Isabella von Treskow Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
18. April 1964
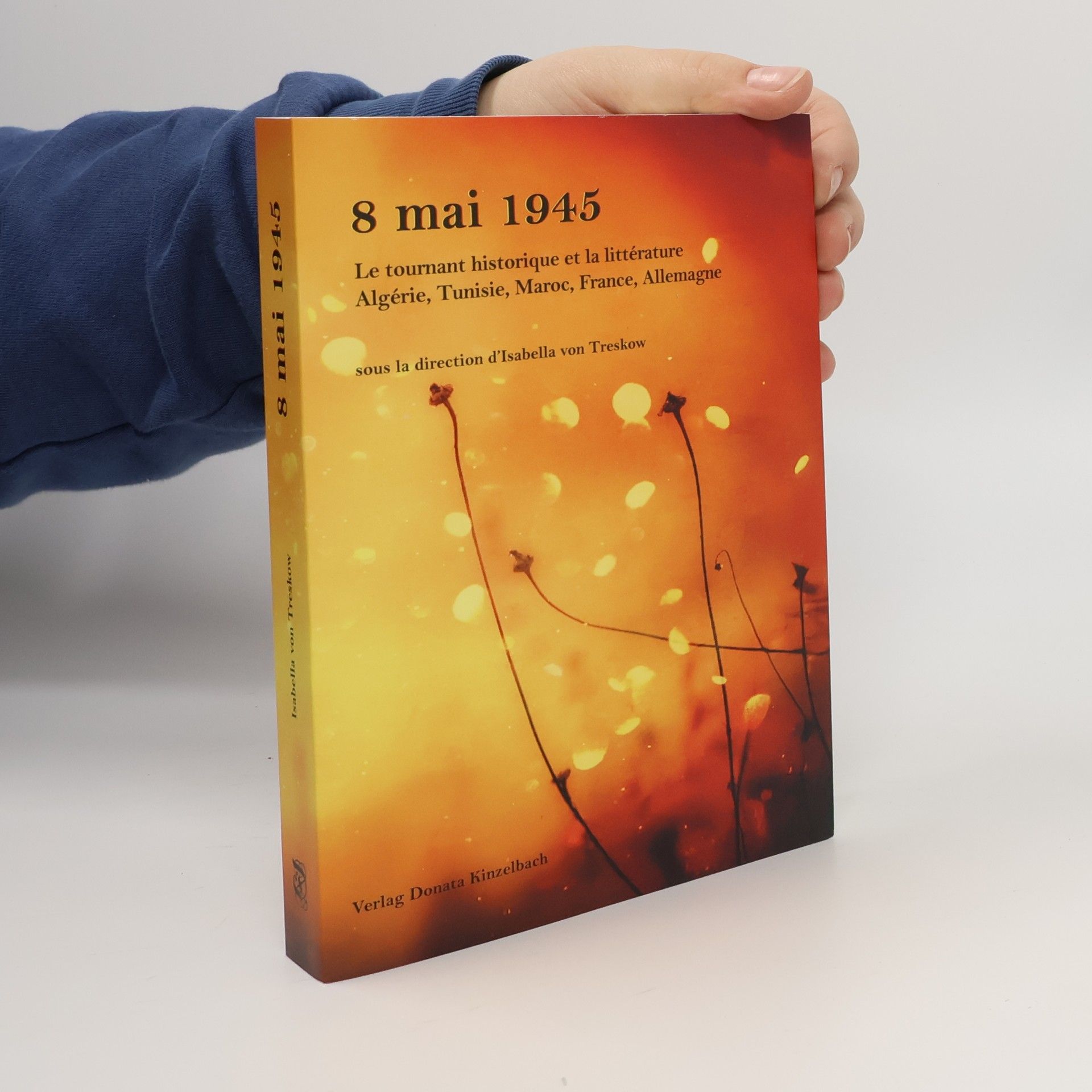


Mitten im Krieg. Mitten in Regensburg
Französische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs in der Domstadt
- 136 Seiten
- 5 Lesestunden
Dass in Regensburg ein Kriegsgefangenenlager wahrend des Ersten Weltkriegs bestand, bildet ein nur wenig beachtetes Kapitel der Regensburger Stadtgeschichte. Es zahlte zu den kleineren Lagern im Deutschen Reich. Dort entfaltete sich zugleich ein reges kulturelles Leben: Die Kriegsgefangenen gaben eine Zeitung heraus, Le Pour et le Contre, sie spielten Theater, sie schrieben und dichteten, sie musizierten und sangen, sie trieben Sport. Der vorliegende Band erlaubt erste Einblicke in eine ferne und doch so nahe Welt.
Schreiben in Gefangenschaft
Kultur und Literatur in Internierungslagern im Ersten Weltkrieg