Geleugnete Verantwortung
- 216 Seiten
- 8 Lesestunden

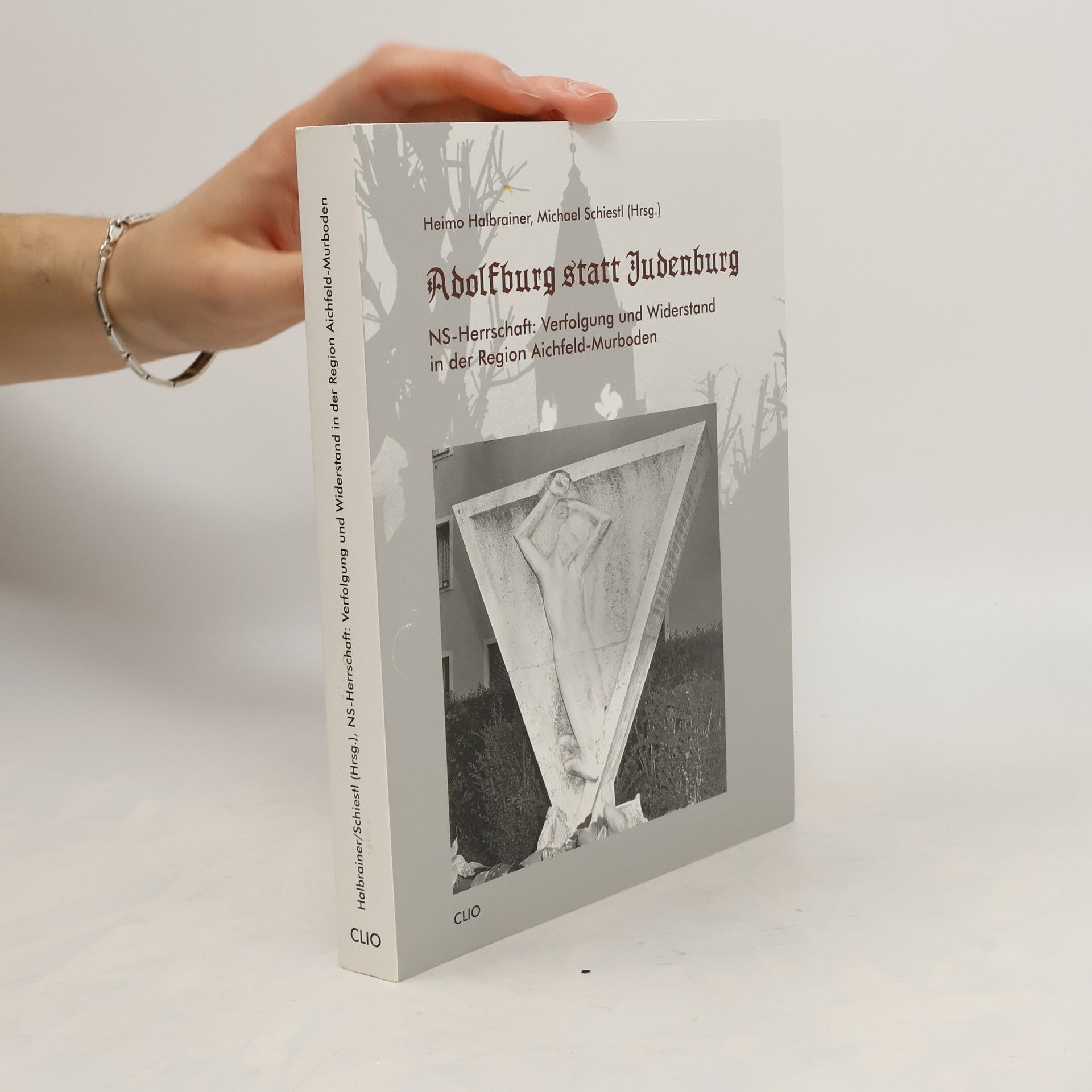
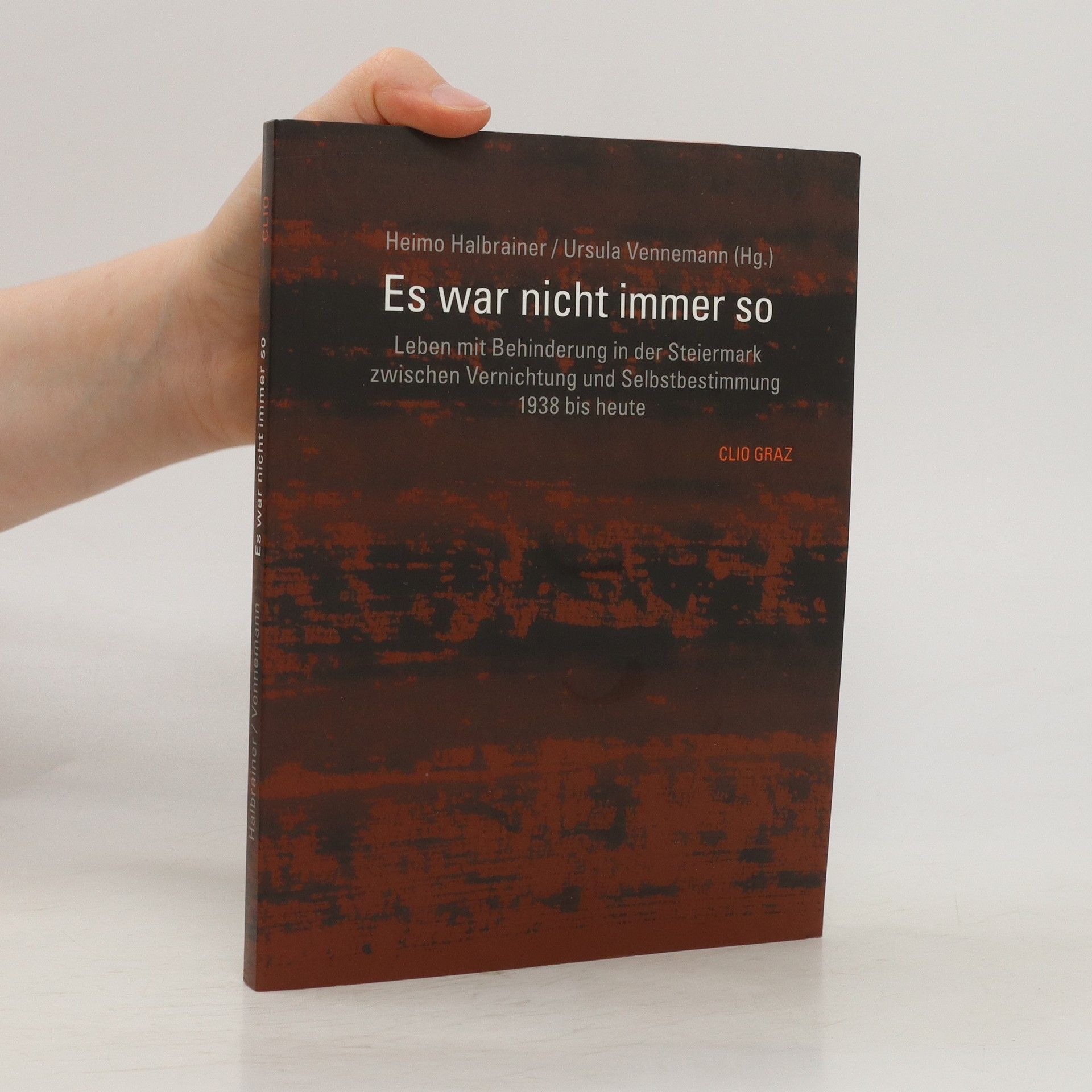



„Herr Leitner, wir, beide Unterzeichnende, ehemalige Häftlinge 117.029 und 117.030 im KZ Buchenwald, sind voller Dankbarkeit für Ihre bewundernswerte und erfolgreiche Arbeit im KZ Buchenwald. Wenn jemand es verdient hat von Yad Vashem geehrt zu werden, so sind es Sie, Herr Leitner.“ Das schrieben der damalige Oberrabbiner des Staates Israel Israel Meir-Lau und sein Bruder 40 Jahre nach der Befreiung an Franz Leitner. Über die Geschichte der Rettung der Kinder im KZ Buchenwald hinaus skizziert der Historiker Heimo Halbrainer in diesem Buch das Leben des 1918 geborenen Franz Leitner von den ersten politischen Aktivitäten in den 1930er-Jahren bis hin zu seiner Tätigkeit nach 1945 als Vizebürgermeister von Wiener Neustadt und Landtagsabgeordneter in der Steiermark.
Leben mit Behinderung in der Steiermark zwischen Vernichtung und Selbstbestimmung 1938 bis heute
NS-Herrschaft: Verfolgung und Widerstand in der Region Aichfeld-Murboden
Bereits wenige Tage nach dem „Anschluss“ 1938 wurden aus der Bevölkerung Vorschläge eingebracht, den Namen der Stadt Judenburg zu ändern, um alles, was an Juden erinnert, zu löschen. Einer der Vorschläge war, „den bisherigen Namen der Stadt Judenburg in Adolfburg umzubenennen“. Wenngleich diese symbolische „Entjudung“ in der Folge nicht umgesetzt wurde, so begannen die tatsächlichen Vertreibungen, Verfolgungen und Vernichtungen in der Region Aichfeld-Murboden mit dem März 1938 und endeten erst durch die Befreiung im Mai 1945. Das Buch dokumentiert erstmals die NS-Herrschaft, die Verfolgung und den Widerstand in der Region Aichfeld-Murboden. Es geht auch auf die Zeit nach 1945 ein und zeigt, wie die Justiz und die Öffentlichkeit mit dem Nationalsozialismus umgegangen sind.
Opfer. Täter. Gegner
Wie kam es zum Aufstieg des Nationalsozialismus in der Steiermark? Welche Erwartungen und Ängste verbanden die Menschen mit diesem Regime? Das Buch untersucht, wie junge Menschen die HJ und den BDM erlebten, was die „Volksgemeinschaft“ ausmachte und wer ihre Feinde waren. Es beleuchtet den Zusammenhang zwischen Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit sowie das Schicksal der steirischen Jüdinnen und Juden im Holocaust und das Leid der Roma und Romnija. Der Terror in der Untersteiermark wird ebenso thematisiert wie der Widerstand gegen das Regime. Ereignisse wie das “Massaker am Präbichl“ und die Aufarbeitung der Verbrechen nach Kriegsende werden eingehend behandelt. Die Erzählung richtet sich an ein breites Publikum, insbesondere an junge Leserinnen und Leser, und bietet eine wissenschaftlich fundierte, gut lesbare Sprache. Über 40 Kurzbiographien beleuchten die Motive und Taten von Nationalsozialisten sowie das Leiden der Verfolgten und die Überzeugungen der Widerstandskämpfer. 309 Abbildungen und Fotografien vermitteln ein eindrucksvolles Bild der Zeit und der NS-Herrschaft in der Steiermark. Ein ausführliches Sach- und Personenlexikon liefert zusätzliche Hintergrundinformationen. Der Inhalt umfasst die Steiermark von 1918 bis 1938, die nationalsozialistische Machtübernahme, die NS-“Volksgemeinschaft“, den nationalsozialistischen Terror und die Zeit von der Befreiung bis zur Gegenwart.
Mit Beiträgen von: Hannes Augustin, Karl Baumgarten, Paul Blau, Lidia Branstätter, Hildegard Breiner, Leopold Buchner, Josef Cap, Harald Edelbauer, Friedrich Fehlinger, Friedl Fessler, Mathilde Halla, Andreas Heigermoser, Johann Hisch, Harald Huscava, Robert Jungk, Thomas Kainz, Erich Kitzmüller, Sam Arnold Kreditsch, Peter Kreisky, Walter Lauber, Peter Ulrich Lehner, Wilfried Leisch, Bernd Lötsch, Wolfgang Maister, Carl Manzano, Schani Margulies, Freda Meissner-Blau, Christoph Mittler, Beatrix Neundlinger, Walter Papousek, Günther Pfaffenwimmer, Heidrun Pirchner, Doris Pollet-Kammerlander, Rainer Possert, Wolfgang J. Pucher, Traudy Rinderer, Sigrid Schönfelder, Elisabeth Schwarz, Franz Sölkner, Karl Stocker, Heinz Stockinger, Maria Summer, Alexander Tollmann, Heinz Unger, Ignaz Vergeiner, Peter Weish, Kurt Winterstein, Friedrich Witzany, Eberhard Wobisch
Im Herbst 1939 verließ die Mürzzuschlagerin Herta Reich mit weiteren 1000 Jüdinnen und Juden auf einem Donauschiff Wien, um sich vor den Nationalsozialisten in Sicherheit zu bringen. Das Ziel ihrer Flucht war Palästina, doch der Transport erreichte nur den kleinen serbischen Donauhafen Kladovo. Fast ein Jahr nach dem Beginn der Flucht wurde die Reise fortgesetzt; doch nicht in Richtung Donaudelta, sondern einige hundert Kilometer stromaufwärts nach Šabac. Dort fielen die Flüchtenden in die Hände der Nationalsozialisten. Bis auf eine Gruppe Jugendlicher, die schon vorher nach Palästina reisen konnte, und einige wenige Erwachsene wurden alle umgebracht. Herta Reich gehört zu den wenigen, die den Nazis entkommen konnte. Nach einer abenteuerlichen Flucht über Italien erreichte sie sechs Jahre nach der Abreise Palästina. „Zwei Tage Zeit“ ist die Schilderung dieser Flucht. Daneben handelt dieses Buch aber auch vom bescheidenen jüdischen Leben in Mürzzuschlag im 19. und 20. Jahrhundert, vom Antisemitismus, den „Arisierungen“ und der Verfolgung und Ermordung der Mürzzuschlager Juden.