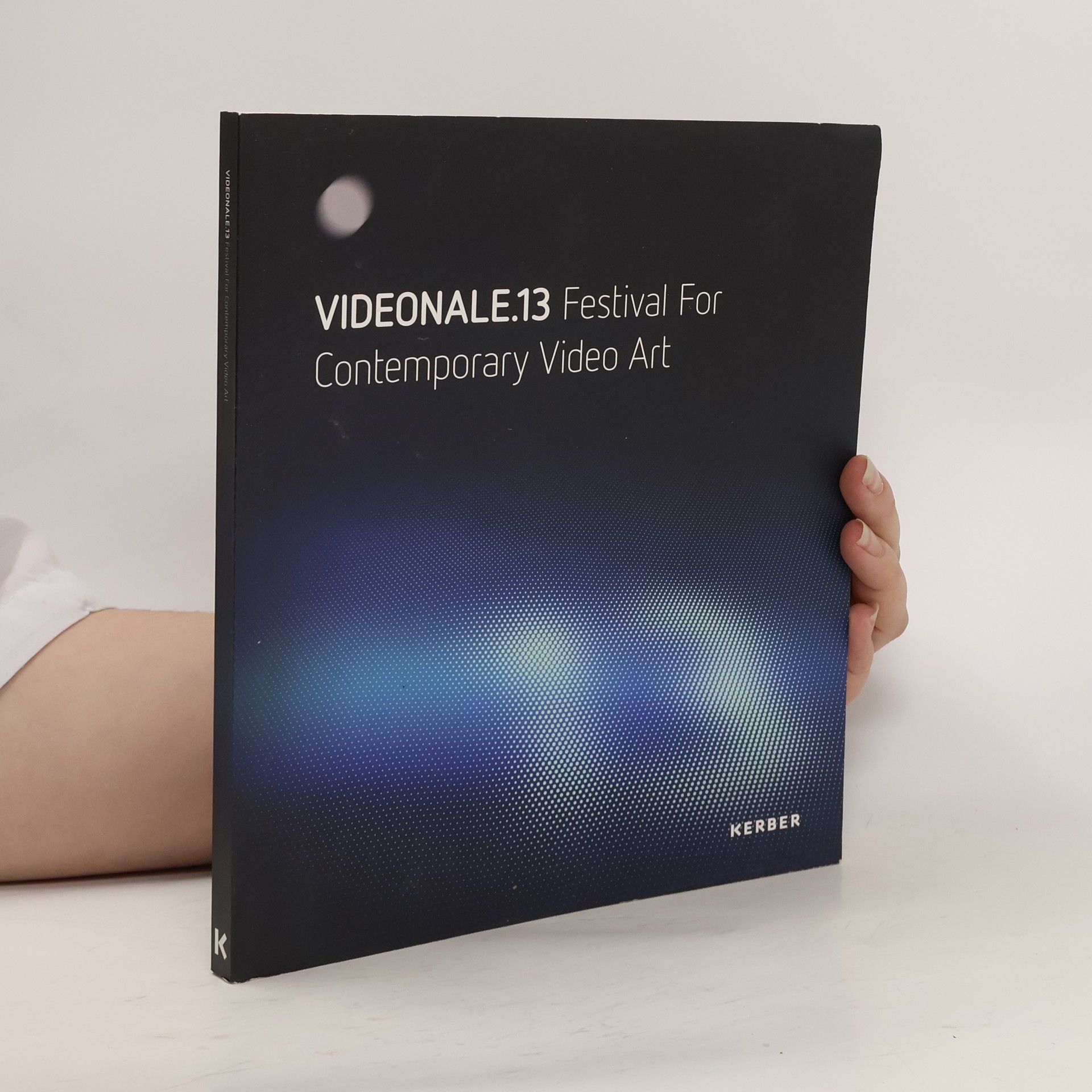Poetik der Reflexion
Heidegger im Lichte der frühromantischen Philosophie
Martin Heidegger zählt zu den umstrittensten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Seine Philosophie stellt eine Herausforderung an moderne Auffassungen von Denken, Freiheit und Sprache dar. Das Buch rekonstruiert seine Entwicklung eines neuen philosophischen Vokabulars und dessen Verbindung zur Lyrik Friedrich Hölderlins.