Diese erste Einführung in die Kultursemiotik stellt Kultur als symbolbasierte Programmatik vor, mit der eine Gesellschaft ihre Lebenswelt (um)gestaltet. Dabei wird deutlich, wie die jeweiligen Zielsetzungen der Weltgestaltung aus dem zweckbestimmten Gebrauch ihrer zentralen Denkfiguren hervorgehen. Anschauliche Beispielanalysen und (Um)deutungsprozesse von Konzepten wie Raum, Zeit, Arbeit, Familie, Geschlecht und Wachstum werfen Schlaglichter auf die ambivalente Entwicklungsgeschichte der westlich kapitalistischen Kultur. So lässt sich soziokultureller Wandel im Zusammenhang mit technologischen Entwicklungen und ökonomischem Gewinnstreben als eine fortwährende symbolische (Ver)Formung der Lebenswelt lesen. Erklärvideos sorgen für einen erleichterten Zugang zu Theorien und Analysen.
Eva Kimminich Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)




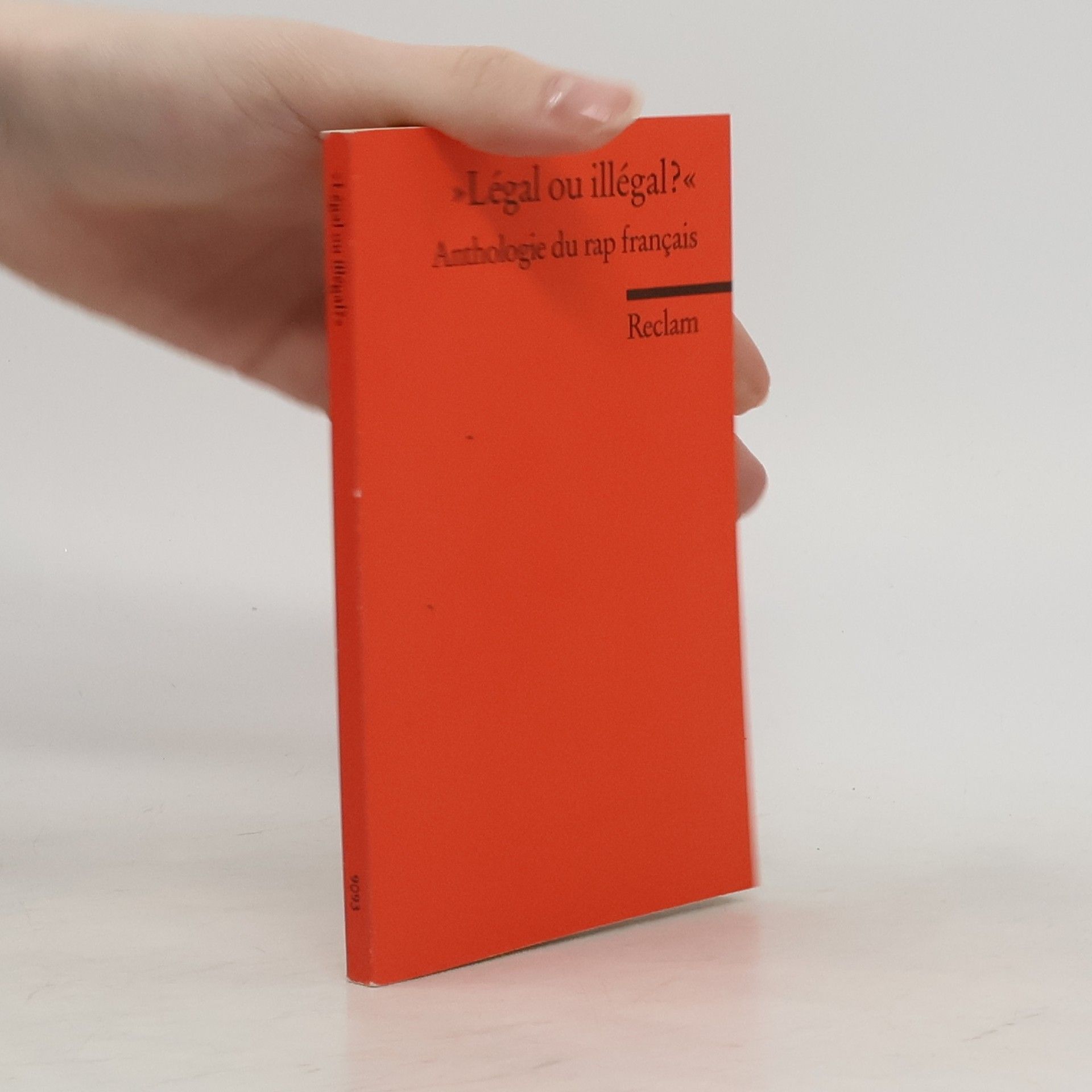
Express yourself!
Europas kulturelle Kreativität zwischen Markt und Underground
Der Diskurs um die Entstehung einer gemeinsamen europäischen Kulturlandschaft hat bisher zwei Aspekte vernachlässigt, die gerade für die junge Generation zentral sind, Körperlichkeit und Kreativität. Daher fragen die Beiträger_innen dieses Bandes einesteils nach den sozialpolitischen, ökonomischen bzw. pädagogischen Bedingungen kreativer Entfaltung. Andernteils beleuchten sie spielerische Techniken der Selbst(er)findung, Körpergestaltung und Selbstdarstellung (HipHop, Tattoo, Techno) bzw. solche, die interaktiv (Tanz) oder medial (Videoclip, Computerspiel) einen Commonsense sich differenzierender Subjekte erzeugen.
Der Band präsentiert rund ein Dutzend kreative Rap-Texte, die die Herausforderungen von Jugendlichen in französischen Betonghettos thematisieren, darunter Drogen, Aids, Kriminalität sowie Rechtsradikalismus und Fremdenhass. Die Texte sind in der Originalsprache mit Übersetzungen schwieriger Wörter und einem Nachwort versehen.
Die historisch-archivalische Studie beschäftigt sich mit den Auswirkungen der aufklärerischen Reformprogramme Josephs II. und Ignaz Heinrich von Wessenbergs auf populäre Ausdrucksformen religiöser Bedürfnisse. Sie konzentriert sich auf ehemals vorderösterreichische Gebiete des Oberrheins und auf Vorarlberg. An religiösen Volksbräuchen wird das Spannungsverhältnis zwischen Steuerungsmechanismen der Obrigkeit und Verhaltensformen der Bevölkerung untersucht. Dabei stehen die parallel verlaufenden Entwicklungsprozesse der Ideen- und der Mentalitätengeschichte im Blickpunkt. Die Ergebnisse liefern Einblicke in das Zusammenwirken gruppenspezifischer Bedürfnisse und kollektiver Entwicklungen innerhalb einer Gesellschaft.
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Kostümgestaltung der Nürnberger Schembartläufer sowie der Fastnachtsgewänder im allgemeinen. Bisher noch unberücksichtigtes Text- und Bildmaterial lieferten jedoch neue Erkenntnisse, sodass sich die Untersuchung zu einer Gesamtbetrachtung der Fastnacht erweiterte und vor allem Laster-, Buss- und Vergeltungslehren einer eingehenden Deutung unterzogen wurden. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Gestaltungsformen und Vermittlungswege der christlichen Lasterlehre. An der Darstellungsweise der Lasterpersonifikationen wird der Ausgangspunkt solcher Motive vom theoretischen Sprachbild theologischer Schriften bis in den Bereich mittelalterlicher Brauchgestaltung nachgezeichnet, wobei der Einfluss abstrakten theologischen Denkens auf populäres Brauchgut am Beispiel der Fastnacht demonstriert wird.