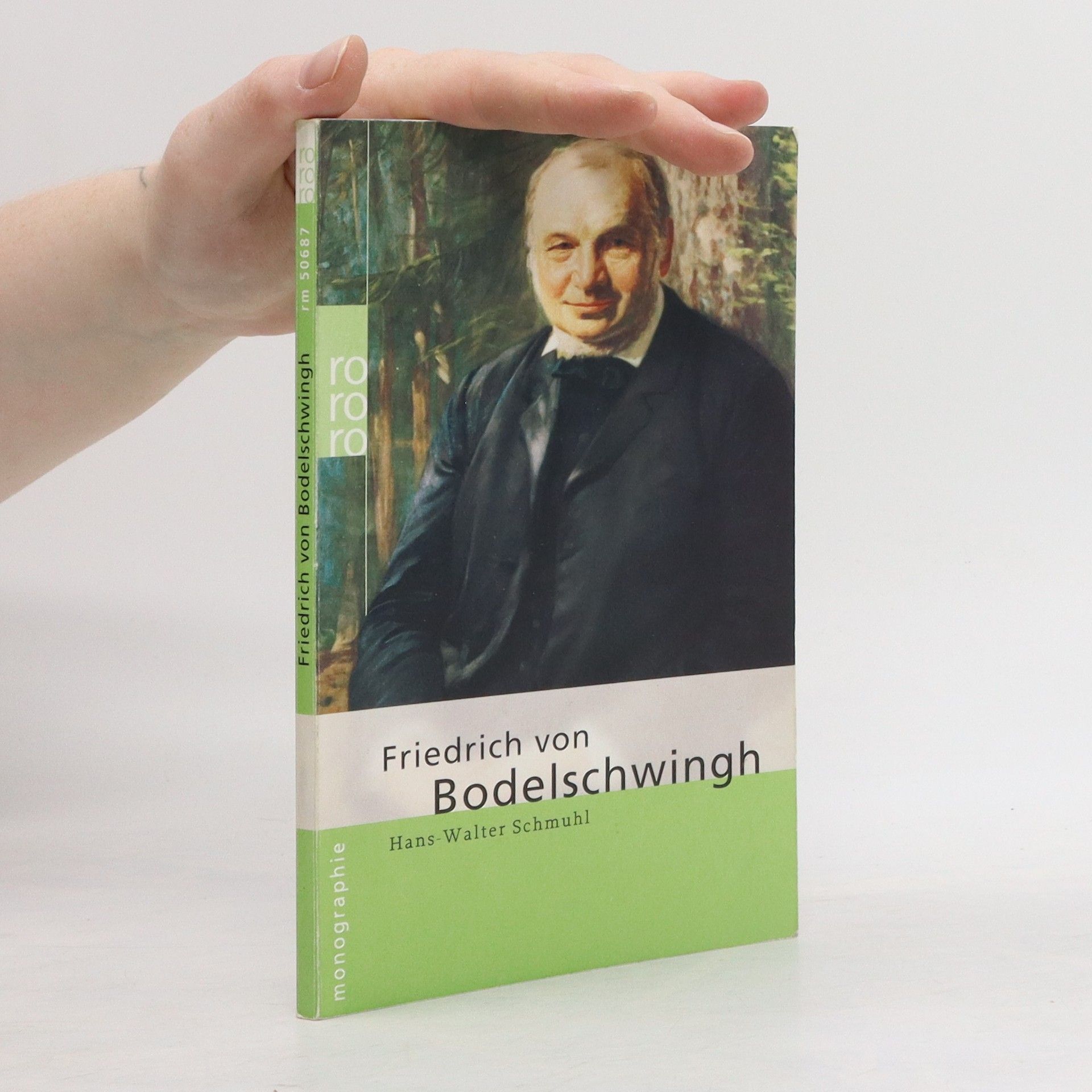Kur oder Verschickung?
Die Kinderkuren der DAK zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- 160 Seiten
- 6 Lesestunden
Von 1951 bis in die 1990er-Jahre hinein führte die DAK etwa 450.000 Kinderkuren durch. Kinder, die »unterernährt«, »blutarm«, »krankheitsanfällig« oder »tuberkulosegefährdet« schienen, wurden zur Erholung in eines der kasseneigenen Heime – »Schuppenhörnle« im Schwarzwald, »Haus Hamburg« in Bad Sassendorf und »Haus Quickborn« in Westerland auf Sylt – geschickt oder in anderen Einrichtungen untergebracht. Gedacht als Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge, wurden die Kinderkuren ganz unterschiedlich erlebt. Manche der verschickten Kinder im Alter von vier bis vierzehn Jahren haben sie in guter Erinnerung, andere litten in den Kurheimen unter Einsamkeit, Heimweh, Verlustängsten und einer strengen Behandlung. Der damals gängigen »schwarzen Pädagogik« folgend, kam es in einigen Fällen zu körperlichen Züchtigungen und anderen demütigenden Strafen, manchmal sogar zu sexuellen Übergriffen. Das Buch nimmt erstmals die Kinderkuren eines großen Trägers systematisch in den Blick, untersucht die quantitative Dimension und die organisatorischen Abläufe und rekonstruiert anhand von Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen den Alltag in den Heimen.