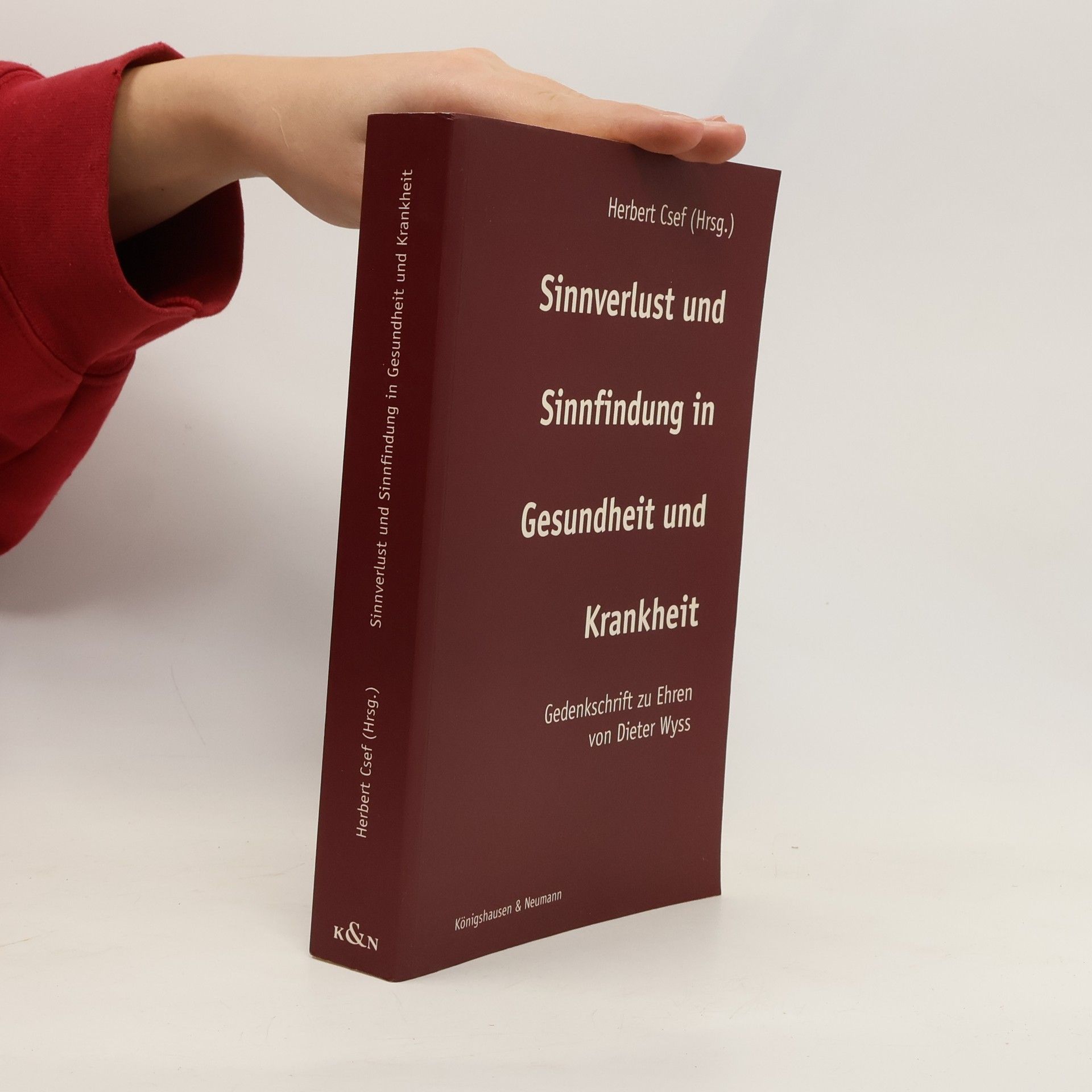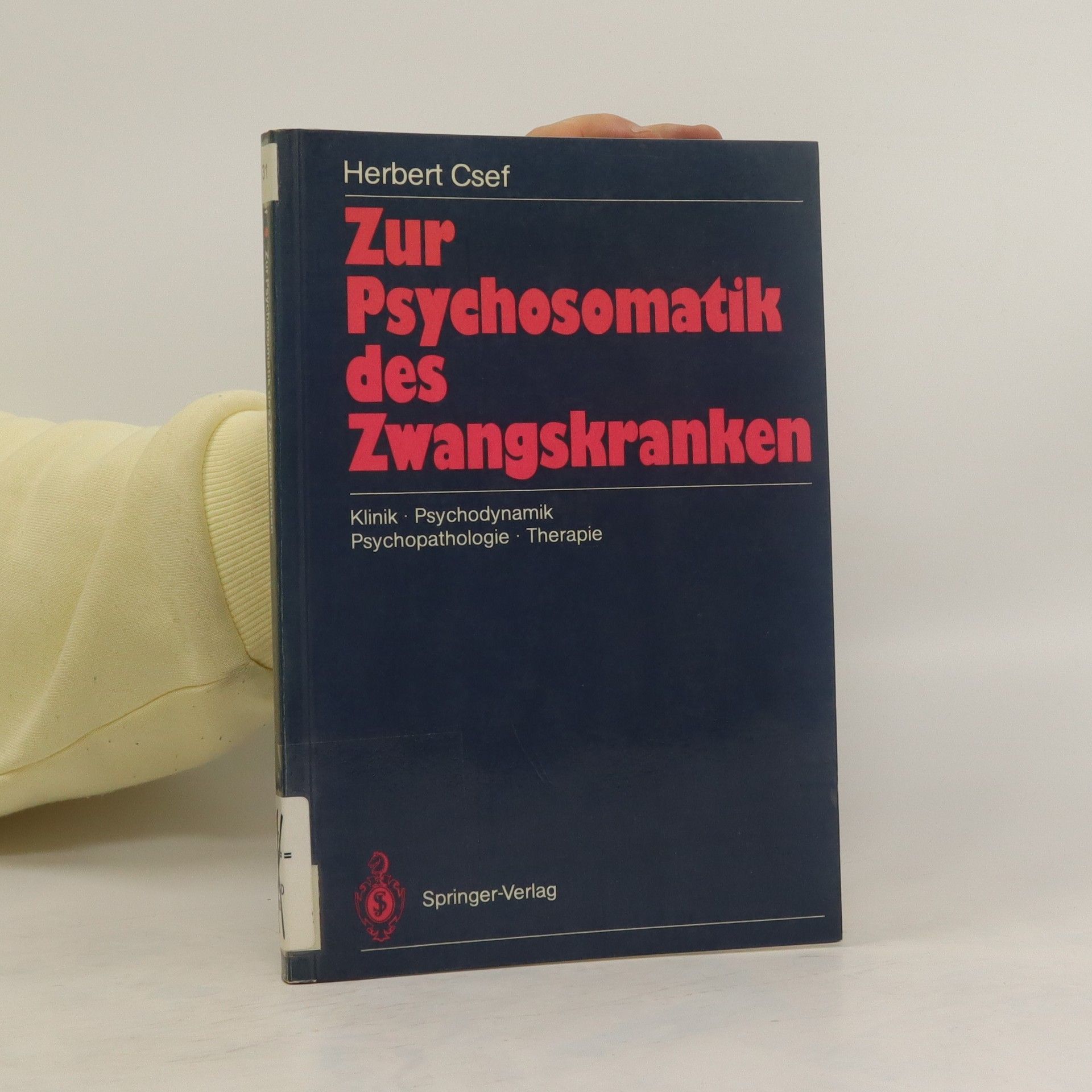Trauma und Resilienz in der Psychoanalyse
- 211 Seiten
- 8 Lesestunden
Die Biografien und Erkenntnisse von Pionieren der Traumaforschung wie Hans Keilson und Boris Cyrulnik bilden den Ausgangspunkt für eine tiefgehende Analyse von Resilienz und posttraumatischem Wachstum. Herbert Csef beleuchtet die Errungenschaften verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, darunter Epigenetik und Neuropsychoanalyse, und zeigt auf, wie diese Erkenntnisse in der klinisch-psychotherapeutischen Praxis angewendet werden können. Durch die Verbindung von Psychoanalyse und positiver Traumatherapie liefert das Buch wertvolle Impulse für die Behandlung von Trauma und dessen transgenerationaler Weitergabe.