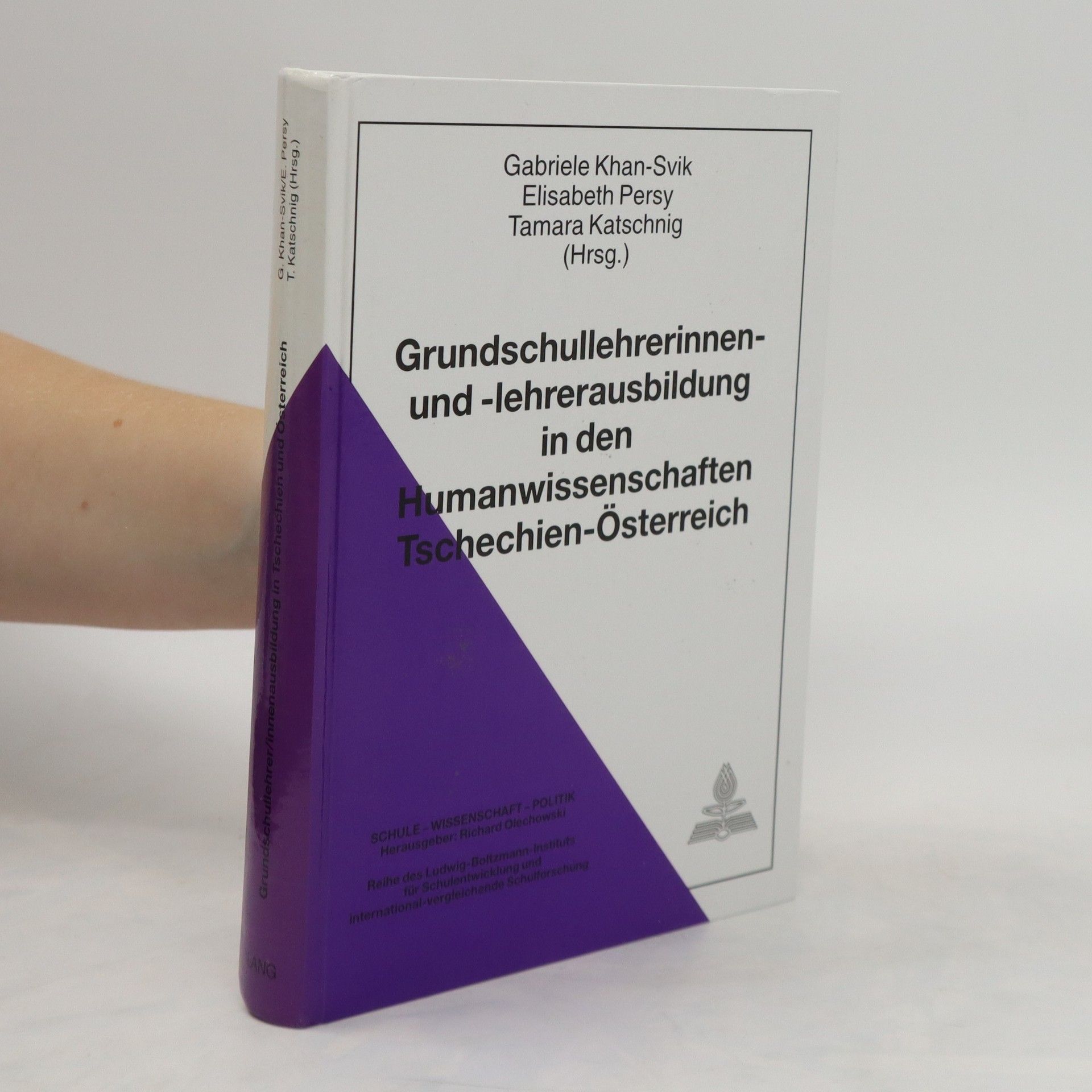SCHULe erLEBEN
Festschrift für Wilhelm Wittenbruch
Die in diesem Band versammelten Beiträge beschäftigen sich mit dem Selbstverständnis der Schulpädagogik, mit anthropologischen, unterrichtstheoretischen bzw. didaktischen Problemen und deren historischer Dimension. Ferner wird das Schulleben als pädagogisches Programm behandelt, die Bedeutung von Allgemeinbildung nach Schule und Beruf erörtert. Es handelt sich bei allen Beiträgen um Originalarbeiten, die speziell für diesen Band verfasst wurden.