Das Mareo/Ennebergische gilt in phonetischer, morphologischer und lexikalischer Hinsicht als besonders eigenständige und originelle Mundart. Die Autoren haben über 13.700 Wörter und Wendungen verzeichnet und in mehrfacher Hinsicht ein Standardwerk zum Dolomitenladinischen geschaffen: Erstmals werden sowohl Vokalqualität als auch die im gesamten Gadertal phonologisch relevante Vokalquantität sowie die Tonstelle der Lemmata durchgehend angeführt, erstmals wird der Versuch gemacht, die Valenz der Verben systematisch anzugeben. Eine reiche Phraseologie ermöglicht Einblicke in die Grundzüge der Syntax des Ennebergischen. Als erstes Nachschlagewerk im Bereich des Gadertals berücksichtigt das Enneberger Wörterbuch die ladinische Schulorthographie. Ein ausführlicher Einleitungsteil bietet einen übersichtlichen Abriss der Laut- und Formenlehre, detaillierte Konjugationstabellen und einen Überblick über die einschlägige Literatur. Von besonderer Bedeutung ist der deutsch - ennebergische Index.
Paul Videsott Bücher
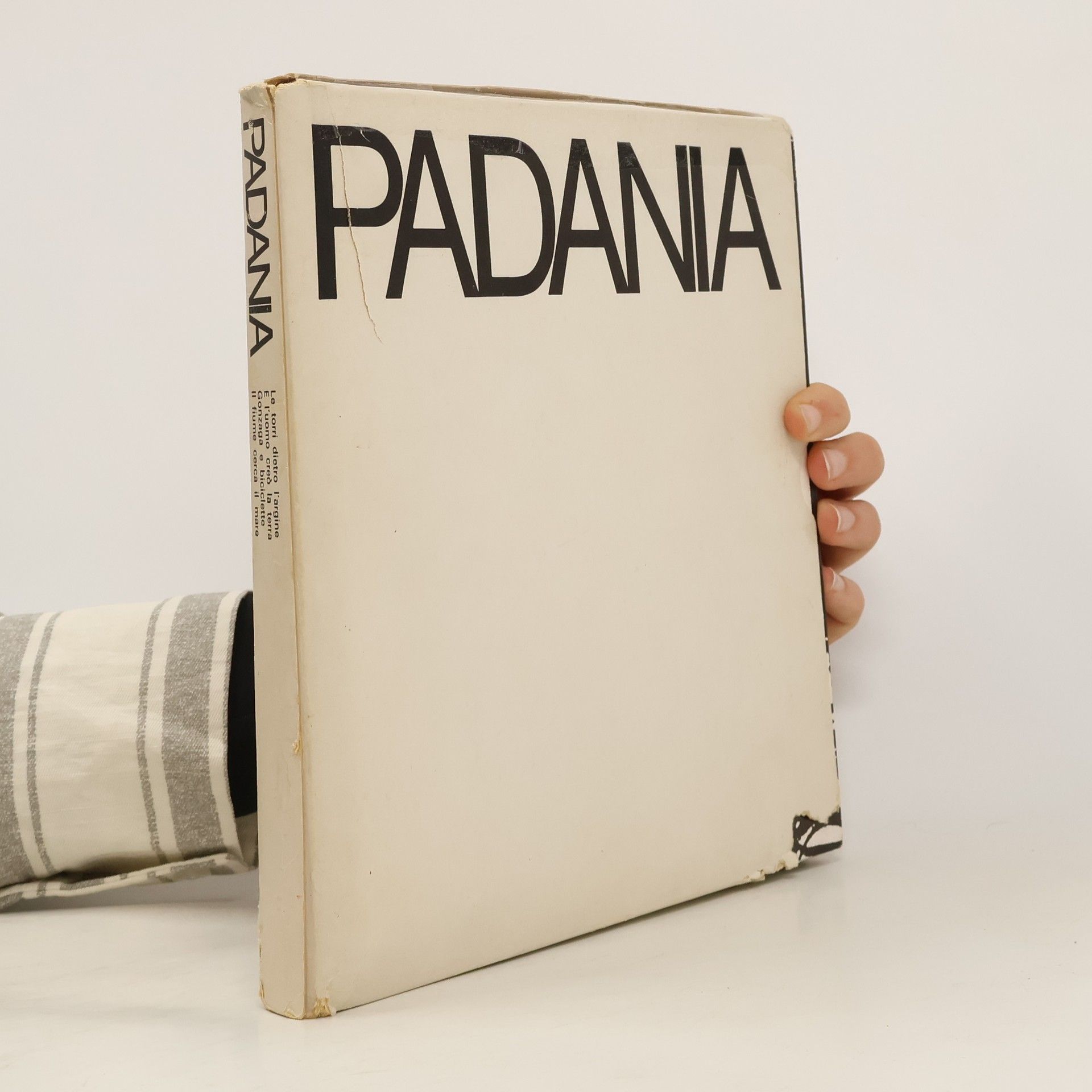

Paul Videsott examines the fate of the vernacular non-literary written language in Northern Italy from its first appearance up to 1525 (the year of publication of P. Bembo’s Prose della volgar lingua ). For this, he undertakes a scriptological and scriptometric analysis of 1165 non-literary Old North Italian texts with a total of 558,892 words from 35 writing centres. Overall, one result is that the North Italian dialects displayed a far greater autonomy towards the emerging Tuscan norm than was the case in France for the Northern French dialects vis-à-vis the imperial Parisian standard language.