Die dynamische Rechtsordnung der Europäischen Union wird durch aktuelle innere und äußere Entwicklungen geprägt, die bedeutende rechtliche Auswirkungen nach sich ziehen. Diese Veränderungen erfordern eine eingehende Analyse der rechtlichen Strukturen und deren Anpassungsfähigkeit an neue Herausforderungen. Das Buch beleuchtet die komplexen Wechselwirkungen innerhalb der EU und deren Einfluss auf die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Mitgliedstaaten und deren Bürger von Bedeutung sind.
Astrid Epiney Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)



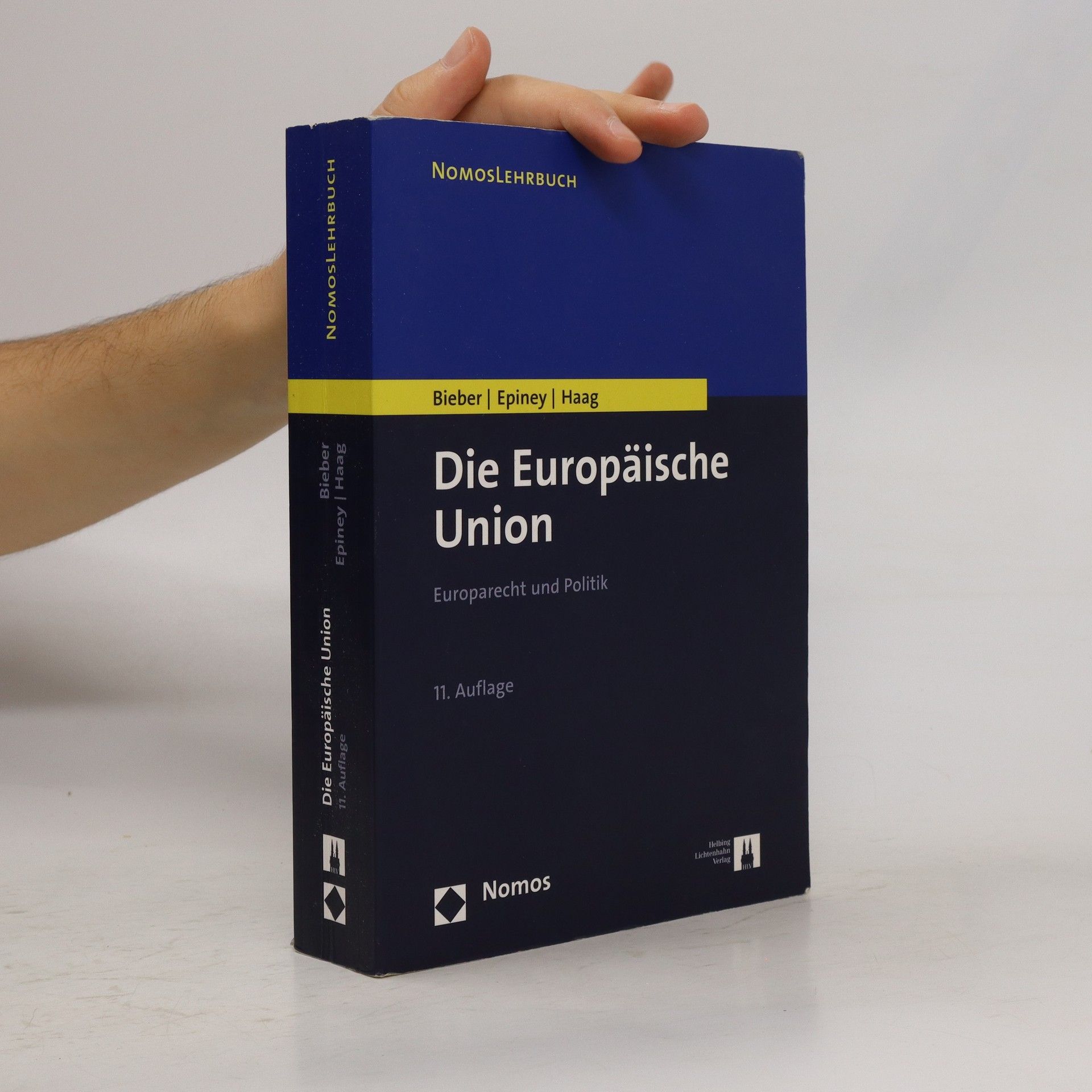
Der vorliegende Band vereint die schriftlichen Fassungen der im Rahmen des 15. Schweizerischen Datenschutzrechtstags 2022 in Freiburg gehaltenen Vorträge. Entsprechend dem Schwerpunkt der Tagung wird das Verhältnis zwischen Datenschutz und Gesundheitsschutz näher untersucht und ein Überblick über aktuelle rechtliche Entwicklungen in diesem Spannungsfeld vermittelt. Im Fokus steht insbesondere die Thematik des Datenschutzes im Zeichen einer Pandemie, die mittels Erfahrungen und Lehren aus der COVID-Krise und Fragestellungen aus der Praxis beleuchtet wird. Eine Darstellung der neuesten (nationalen und internationalen) Rechtsprechung im Bereich des Datenschutzrechts allgemein schliesst diese Publikation ab. Le présent ouvrage rassemble les rapports présentés lors de la 15e Journée suisse du droit de la protection des donnés 2022 organisée à Fribourg. Différents aspects juridiques autour de la relation entre la protection des données et la protection de la santé sont analysés et les récents développements dans ce domaine sont abordés. L’accent est mis sur la thématique de la protection des données en temps de pandémie, au regard des expériences et des enseignements tirés de la crise COVID ainsi que de questions pratiques. Finalement, la jurisprudence récente (nationale et internationale) en matière de protection des données en général est résumée.
Die Europäische Union
- 704 Seiten
- 25 Lesestunden
Studenten, die sich mit dem Europarecht beschäftigen, stehen vor der Frage, welches Lehrbuch sie nutzen, um sich dieses vielfältige und spannende Rechtsgebiet anzueignen. Mit dem Bieber/Epiney/Haag sind sie auf der sicheren Seite! Das Autorenteam aus Wissenschaft und Praxis gewährleistet, dass der immer komplexer werdende Stoff gleichmäßig durchdrungen und gemessen an der Fülle komprimiert dargestellt wird. Die 11. Auflage ist auf aktuellem Stand und erörtert bereitsdie institutionellen und materiell-rechtlichen Folgen des Lissabon-Vertrages, alle späteren Ergänzungsverträge (Fiskalpakt und Europäischer Stabilitätsmechanismus), die umfassende nationale Ausführungsgesetzgebung, die neueste Rechtsprechung des EuGH und der nationalen Höchstgerichte. Vor dem Hintergrund der dramatischen Entwicklungen des internationalen Währungssystems und der außenpolitischen Herausforderungen bietet das Werk eine Gesamtschau auf die Eigenart und die Eigendynamik des Europarechts anhand der Verträge und der institutionellen Praxis, zahlreicher Entscheidungen sowiederen Wirkungen in den Mitgliedstaaten und im internationalen Bereich.