Christian Hillen Bücher


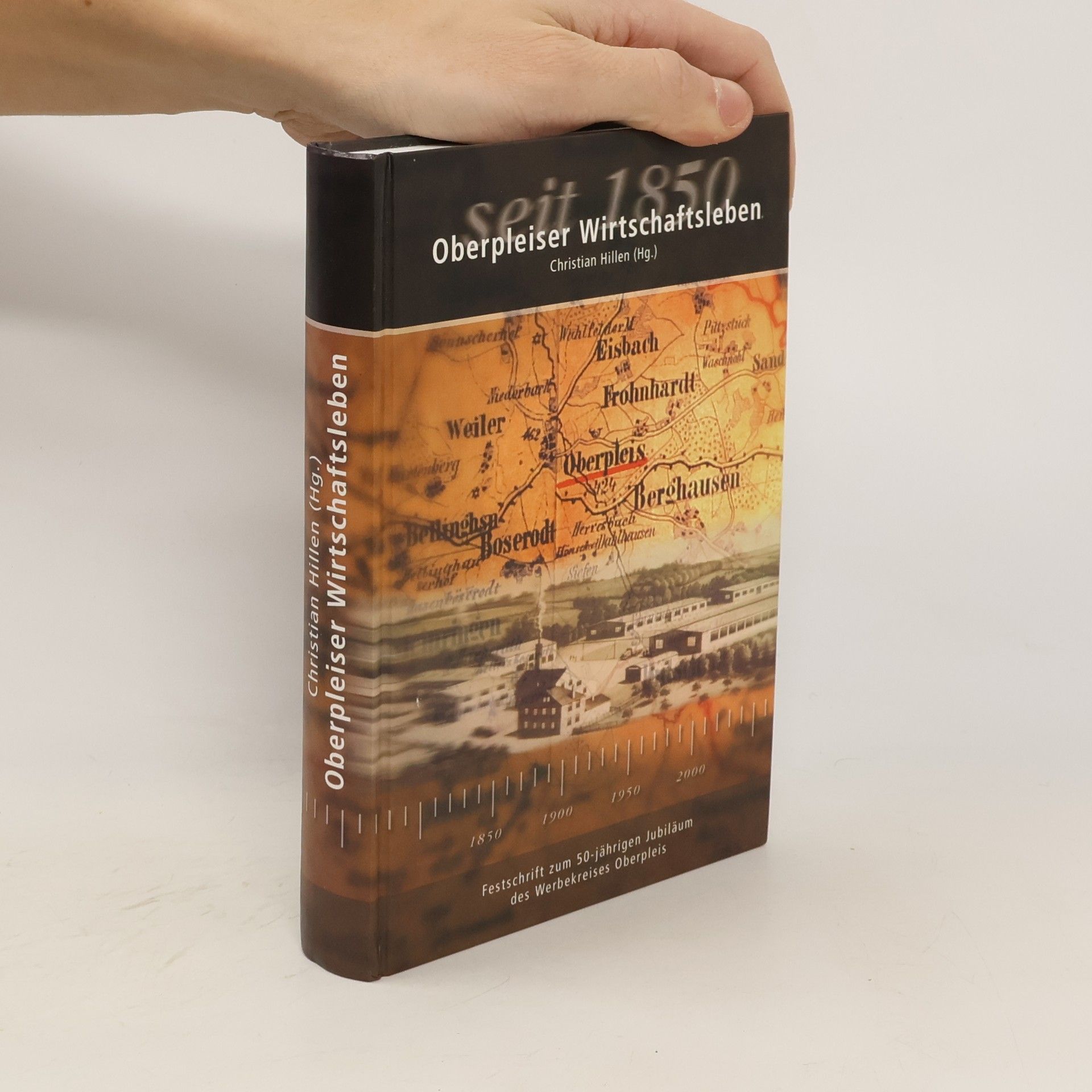
Geschichte in Köln 70 (2023)
Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte
Vor 45 Jahren entstand der erste Band von "Geschichte in Koln" (GiK). Fur die anfangs halbjahrlich erscheinende Zeitschrift liegt nun der 70. Band vor. Er bietet wieder ein breites Spektrum von Beitragen und Buchbesprechungen zur Kolner Stadt- und rheinischen Landesgeschichte vom Fruhmittelalter bis in die Zeit der "Bonner Republik". Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Koelhoffschen Chronik, der ersten gedruckten und bekanntesten historischen Darstellung der Kolner Geschichte. Neu diskutiert wird u. a. die Frage, wer sie eigentlich geschrieben hat, wie sie im Umfeld der Kartauser zu verorten ist und wie man sie heutzutage im digital organisierten akademischen Unterricht benutzen kann. Ganz neu ist die Rubrik "Aus dem Kolnischen Stadtmuseum", unter der nun regelmassig auf Objekte und Quellen zur Geschichte Kolns aufmerksam gemacht wird.
Geschichte in Köln 69 (2022)
Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte
Die aktuelle Ausgabe der Geschichte in Koln wartet mit einem Lebensbild des 1021 verstorbenen Kolner Erzbischofs Heribert auf, widmet sich der Frage, auf wen die mittelalterliche Kolner Stadtmauer zuruckgeht, beschaftigt sich mit der Mobilitat der stadtischen Fuhrungsschicht im Mittelalter, mit den in gleicher Epoche immer wieder uber Koln verhangten Interdikten, mit Verordnungen, bei deren Verbreitung sich der stadtische Rat im 16. Jahrhundert des noch neuen Mediums Druck bediente, sowie mit dem unerlaubten Nachdruck von Publikationen, gegen den man sich im 18. Jahrhundert durch Privilegien zu schutzen versuchte. Konkrete Objekte stehen im Mittelpunkt von Beitragen uber lothringische Steinskulpturen der Gotik in Koln, fruhneuzeitliche Kissen sowie Taufbecken aus dieser Zeit. Ins rechtsrheinische Koln fuhren Aufsatze uber die Strunde sowie zu archaologischen Untersuchungen im Bereich der ehemaligen Farbrikationsanlagen der Waggonproduktion von van der Zypen & Charlier. Das 20. Jahrhundert ist mit je einem Beitrag uber judische Kunsthandler Kolns von der Weimarer Republik bis zur Nachkriegszeit und zu einer 1958 abgeschlossenen europaischen Ringpartnerschaft zwischen sechs Stadten vertreten. Abgerundet wird der Band durch drei Miszellen und Besprechungen jungst erschienener Bucher.