Inklusions-Material Geschichte Klasse 5-10
- 144 Seiten
- 6 Lesestunden
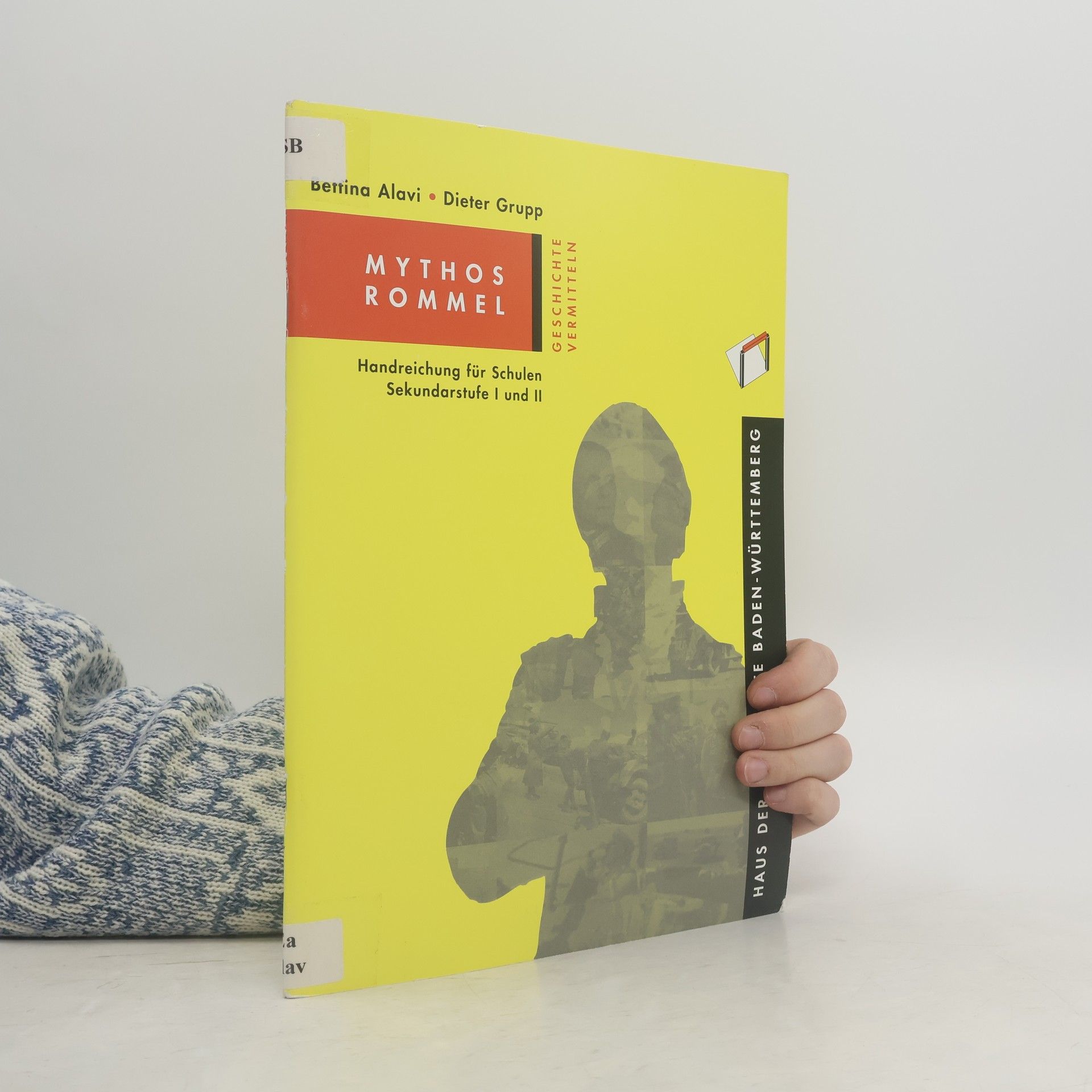


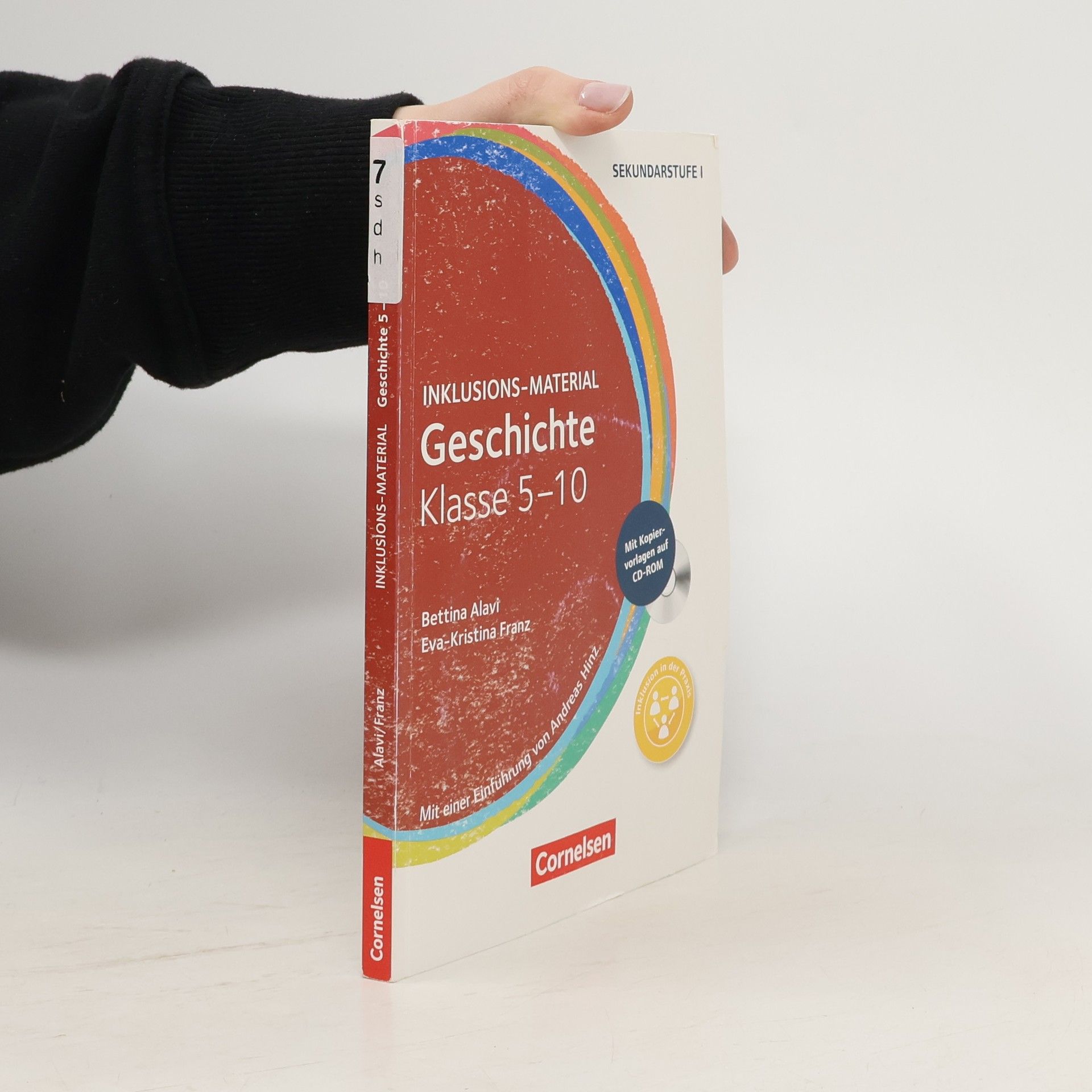
"Verstehen sichern" ist das zentrale Anliegen dieses Buches, das die fachdidaktische mit der sonderpädagogischen Perspektive verknüpft. Die Autorinnen stellen die Schüler*innengruppe der Hörgeschädigten in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Sie erläutern Auswirkungen dieser unsichtbaren Behinderung auf sprachliche Verstehensprozesse, die kognitive und emotionale Entwicklung sowie auf den Aufbau des Geschichtsbewusstseins und entwickeln ein inklusives Setting, das diesen differenten Entwicklungen auf drei Ebenen didaktisch der Klassenraumgestaltung, der Visualisierung und Strukturierung der Lerninhalte sowie der Veranschaulichung und Entlastung von Sprache. An zwei Beispielen für den Geschichtsunterricht werden diese verstehenssichernden Maßnahmen veranschaulicht. Das Buch enthält zahlreiche Anregungen für den Umgang mit Verstehensproblemen und ist auch für den inklusiven Unterricht in anderen kommunikationsintensiven Fächer wie Politik, Religion und den Fremdsprachen hilfreich.